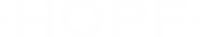Tiergeräusche, die nicht in den Dschungel passten, drangen an Tibors Ohren. Er hielt inne und spähte nach der Herkunft der Laute. Sein Freund Kerak verharrte neben ihm. Der Gorilla kratzte sich am Schädel.
»Was ist das, Tibor?«
»Es kommt aus dieser Richtung.«
Sie liefen durch das Unterholz, vorbei an mächtigen Urwaldriesen, bis sie Bewegungen ausmachten. Auf einer kleinen, mit Gras bewachsenen Lichtung ästen zwei Vierbeiner. Die Freunde duckten sich hinter ein paar Büsche.
»Sieh dir das an, Kerak! Sind das nicht zahme Rinder?«
»Ja, diese Tiere leben bei den Zweibeinern«, bestätigte der Affe. »Wie sind sie hierhergekommen?«
»Wahrscheinlich sind sie ihren Herren davongelaufen. Es muss ein Dorf in der Nähe sein.«
»Was hast du vor?«
Der Sohn des Dschungels sah sich nach Lianen um. Sie wuchsen überall. »Wir fangen die Rinder ein. Ich will sie ihren Eigentümern zurückbringen, bevor sie von Raubtieren gerissen werden. Warte hier! Wenn sie dich sehen, nehmen sie sonst Reißaus.«
In aller Eile schnitt Tibor einige starke Lianen ab, wobei ihm das Messer, das er von Major Deakins erhalten hatte, wertvolle Dienste leistete. Die Rinder ästen ruhig weiter, als er sich ihnen näherte. Das bewies, dass sie die Gesellschaft von Zweibeinern gewohnt waren. Er legte den Tieren die Lianen um und band sie fest. Sie ließen es gleichmütig über sich ergehen.
»Du kannst herauskommen, Kerak!«, rief Tibor seinem Freund zu.
Der Gorilla verließ sein Versteck und gesellte sich zu ihm. Die Rinder scheuten ein wenig, doch sie beruhigten sich schnell wieder, als sie merkten, dass ihnen von dem großen Affen keine Gefahr drohte. Tibor reichte Kerak die losen Enden der Lianen.
»Gib acht, dass sie nicht wieder davonlaufen. Ich klettere auf einen Baum. Vielleicht kann ich das Dorf von oben sehen.«
Er stieg auf den nächsten Urwaldriesen und hockte sich in eine Astgabel. Von seiner Position aus hatte er einen guten Überblick über das Land. Zwischen sanft geschwungenen Hügeln erstreckte sich eine Talsenke, in der tatsächlich ein Dorf lag. Es war zu weit entfernt, um Einzelheiten erkennen zu lassen. Tibor kletterte vom Baum herunter und teilte Kerak seine Entdeckung mit.
»Wir brauchen keinen Umweg zu machen«, sagte er. »Das Dorf liegt genau in unserer Richtung.«
»Dann lass uns aufbrechen. Bestimmt werden die Zweibeiner uns freundlich empfangen, weil wir ihnen ihre Tiere zurückbringen.«
Tibor nickte und ergriff die als Zügel dienenden Lianen. »Das denke ich auch.«
Die beiden Freunde setzten ihren Weg durch den lichter werdenden Dschungel fort. Die Rinder trotteten gehorsam hinter ihnen her. Auf ihrem Weg zum Dorf begegnete den Freunden niemand.
»Eigenartig«, wunderte sich Tibor.
»Was denn?«
»Anscheinend sind keine Eingeborenen auf der Suche nach den Rindern.«
»Ob ihr Verschwinden unbemerkt geblieben ist?«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Tiere sind sehr wertvoll für die Dorfbewohner.«
Die Bäume blieben hinter ihnen zurück. Schließlich stießen die Gefährten auf einen Trampelpfad. Die Ansammlung von Hütten war von einem Palisadenzaun umgeben, der davor liegende Landstreifen gerodet.
»Fällt dir etwas auf, Kerak?«
»Nein, Tibor.«
»Das ist es eben. Aus dem Dorf ist kein Laut zu hören. So still sind die Eingeborenen doch sonst nicht.«
Der Eindruck bestätigte sich, als die Freunde das Hüttendorf betraten. Die einfachen Katen lagen scheinbar verlassen vor ihnen. Kein Mensch war zu sehen. Vielleicht hatten die Bewohner sich an anderer Stelle versammelt, auf dem meist zentral gelegenen Dorfplatz möglicherweise. Tibor lauschte angestrengt nach Stimmen. Es war vergeblich. Er deutete auf einen in den Boden gerammten Pfahl.
»Binde die Rinder dort drüben an, Kerak! Ich sehe mich im Dorf um.«
Tibor machte sich auf den Weg. Er fragte sich, wo die Bewohner stecken mochten. Sein Blick ins Innere einiger Hütten blieb erfolglos. Niemand hielt sich darin auf, deshalb ging er weiter. Als er den Rand des Dorfplatzes erreichte, blieb er wie vom Donner gerührt stehen.
In der Mitte des Platzes standen zwei mächtige, mit Schnitzereien verzierte Stelen, zwischen deren oberen Enden eine Querstange befestigt war. Ein Schwarzer war an den Handgelenken an dem Gerüst aufgehängt. Seine Füße schwebten einen halben Meter über dem Boden.
Heiß brannte die Sonne auf ihn herab, und er rührte sich nicht. Wenige Schritte entfernt standen zwei weitere Dorfbewohner im Schatten eines Sonnendachs. Sie trugen Speere und Schilde.
Es sind Wachen, überlegte Tibor. Was mochte das alles zu bedeuten haben?
Vielleicht handelte es sich bei dem Aufgehängten um einen Verbrecher, und die Dorfgemeinschaft bestrafte ihn auf diese grausame Weise. Die Eingeborenen unterstanden zwar dem Distriktsbeamten, doch was auf Papier geschrieben stand, ließ sich noch lange nicht überall durchsetzen. In dem entlegenen Gebiet, in das es Tibor verschlagen hatte, handelten die Einheimischen womöglich nach alten Stammesgesetzen, obwohl das streng verboten war. Noch hatten die Wachen ihn nicht bemerkt.
Er brauchte nicht lange zu überlegen. Er konnte es nicht zulassen, dass ein Mensch unter der glühenden Sonne einen qualvollen Tod starb, ganz gleich was er getan hatte. Entschlossen trat er auf den Platz hinaus und hob einen Arm als Geste der Freundschaft.
»Tibor, der Sohn des Dschungels, grüßt euch.«
Die beiden Wachen fuhren herum. Für einen Moment starrten sie ihn ungläubig an.
»Ein Fremder«, brachte einer von ihnen überrascht hervor.
»Tod dem Fremden!«, stieß der andere aus.
Ehe Tibor sich versah, schleuderten sie ihre Speere. Geistesgegenwärtig duckte er sich und entging den tödlichen Waffen.
»Auf ihn! Der Fremde darf das Dorf nicht verlassen.«
Schon griffen sie an. Von zwei Seiten gingen die Eingeborenen auf Tibor los. Nur seiner Schnelligkeit hatte er es zu verdanken, dass er keinen Hieb einsteckte. Es entwickelte sich ein heftiger Kampf, und Tibor verteidigte sich nach Leibeskräften. Er gewann zwar die Oberhand, doch es gelang ihm nicht, einen entscheidenden Treffer anzubringen. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als er tiefes Grollen vernahm.
Kerak griff in den Kampf ein. Der Schreck fuhr den beiden Angreifern in die Glieder, und Tibor brachte einen von ihnen mit einem harten Schlag unters Kinn zu Fall. Den anderen schickte Kerak ins Reich der Träume. Es dauerte nur Sekunden, bis der Kampf entschieden war und die Wachen regungslos am Boden lagen. Tibor sah sich um. Es ließen sich keine weiteren Schwarzen sehen. Der Lärm des Kampfgetümmels war ungehört verklungen.
»Fessele die beiden, Kerak, und bringe sie in eine Hütte!«, rief der Sohn des Dschungels seinem Freund zu. »Ich befreie den Unglücklichen von seinen Fesseln.«
Während der Gorilla tat wie ihm geheißen, durchschnitt Tibor die Stricke, mit denen der Gefangene festgebunden war. Vorsichtig ließ er den Bewusstlosen zu Boden gleiten. Rasch untersuchte Tibor ihn. Er hatte keine erkennbaren Verletzungen davongetragen.
»Ist er am Leben?«, fragte Kerak, der wenig später zurückkam.
»Ja, aber lange hätte er in der brennenden Sonne nicht mehr durchgehalten.«
Tibor hatte die Worte kaum ausgesprochen, als sich der Eingeborene zu rühren begann. Seine Lider flackerten, dann öffnete er die Augen zu zwei schmalen Schlitzen. Er riss sie weit auf, als er den großen Affen entdeckte. Er schrie entsetzt auf.
»Ein böser Geist! Bonto ist bereits im Land der Toten.«
»Ruhig, Bonto! Du bist nicht im Land der Toten. Du lebst«, redete Tibor auf ihn ein. »Und das ist kein böser Geist, sondern ein Gorilla. Kerak ist mein Freund. Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben.«
»Wirklich nicht?« Bonto beäugte den Affen misstrauisch. »Und ich lebe noch?«
»So ist es. Warum wollten dich deine Stammesgenossen an dem Gerüst sterben lassen?«
»Wir müssen schnell fort, bevor die anderen zurückkommen«, überging der Befreite die Frage. Er versuchte sich aufzurichten und sackte stöhnend wieder in sich zusammen.
Bontos Furcht ließ es Tibor ratsam erscheinen, vorerst das Weite zu suchen. Für Fragen war später noch Zeit. Zunächst mussten sie den Geretteten in Sicherheit bringen. Anschließend konnte er herausfinden, ob er es tatsächlich mit einem Schurken zu tun hatte.
»Trage ihn, Kerak! Er ist noch schwach.«
»Was machen wir mit ihm?«
»Wir gehen hinaus in den Dschungel. Dort kann er uns berichten, was geschehen ist.«
Nachdem Kerak Bonto aufgenommen hatte, verließen sie das Dorf, ohne auf jemanden zu treffen.
*
Tibor hatte den verängstigten Schwarzen in eine Baumkrone gebracht. In einer Astgabel liegend, kam er allmählich wieder zu Kräften. Angst hatte sich in seine Gesichtszüge gegraben. Er fürchtete sich vor mehr als nur den anderen Kriegern.
»Jetzt erzähle!«, forderte Tibor ihn auf. »Was ist in deinem Dorf geschehen?«
»Der tödliche Schatten ist schuld an unserem Unglück«, krächzte Bonto, wobei er sich voller Verzweiflung an den Kopf fasste.
Der Sohn des Dschungels horchte auf. »Der tödliche Schatten? Was ist das?«
»Ein riesiger Büffel, der jeden Menschen ohne Grund angreift. Er kommt immer aus dem Hinterhalt und in der Dämmerung. Deshalb nennen wir ihn den tödlichen Schatten.«
»Ein einzelner Büffel? Warum verteidigt ihr euch nicht gegen ihn?«
»Seit Wochen haben wir versucht, ihn zu töten. Es ist uns nicht gelungen. Er ist einfach zu schlau für uns. Mehr als einmal sind die Jäger zu Gejagten geworden. Nicht wenige mussten ihren Mut mit dem Leben bezahlen.«
Das klang wirklich nicht gut. Mit einem Kopfnicken forderte Tibor Bonto auf, weiterzureden.
»Gestern Nacht hat unser Zauberer Umbu die Geister angerufen und sie um Hilfe für unseren Stamm angefleht.«
»Er hätte besser einen Boten zum Distriktkommandanten schicken sollen.«
»Wir wollen nichts mit den Weißen zu tun haben.«
»Sie helfen euch, wenn ihr euch an sie wendet.«
»Die Geister haben zu unserem Zauberer gesprochen«, überging Bonto die Behauptung.
»Was haben sie gesagt?«
»Sie haben bestimmt, dass mein Sohn Kolu heute Nacht dem heiligen Krokodil geopfert werden muss.«
»Was?« Tibor erschrak heftig. »Wozu soll das gut sein?«
»Der Zauberer sagt, das heilige Krokodil wird aus Dankbarkeit den Büffel töten, wenn er zum Fluss kommt, um seinen Durst zu stillen.«
Tibor antwortete nicht. Natürlich würde kein Krokodil seine Dankbarkeit zeigen, nur weil man ihm ein Kind opferte. Der Aberglaube war nur schwer aus den Köpfen der Einheimischen herauszubekommen, aber er hatte kein Recht, darüber zu urteilen.
»Warum solltest du sterben?«, wollte er wissen. »Weshalb haben deine Stammesgenossen dich an dem Gerüst aufgehängt?«
»Weil ich verblendet war«, murmelte Bonto. Er schlug die Augen nieder. »Kolu ist mein einziger Sohn. Ich wollte verhindern, dass er stirbt. Deshalb widersetzte ich mich dem Opfer.«
»Du warst nicht verblendet. Unter keinen Umständen muss dein Sohn sterben. Auch ohne dass er geopfert wird, wird das Krokodil den Büffel angreifen, wenn er ihm die Gelegenheit dazu gibt.«
»Der Zauberer behauptet etwas anderes.«
»Ihr wisst doch, dass das Gesetz des weißen Mannes Menschenopfer verbietet und unter schwere Strafe stellt.«
»Wir wissen es.« Bonto ließ den Kopf hängen. »Aber die Weißen sind weit weg. Es ist über ein Jahr vergangen, seit der letzte hier war.«
Und das nutzten die Eingeborenen aus. Tibor konnte es ihnen nicht einmal verdenken.
»Die Männer haben Kolu zum Fluss geschafft?«
»Ja.«
Tibor dachte nicht daran, den Jungen seinem Schicksal zu überlassen. »Ich will versuchen, deinen Sohn zu retten und den tödlichen Schatten unschädlich zu machen.«
»Das willst du für mich wagen?«, fragte Bonto erstaunt. Auf einmal keimte ein Hauch von Hoffnung in ihm auf.
»Nicht nur für dich. Ich möchte, dass ihr Vertrauen zu den weißen Männern fasst und in Zukunft von den schrecklichen Menschenopfern ablasst. Ich möchte genau wissen, wo die anderen Dorfbewohner sind.«
»Sie sind alle am Fluss, um der Opferung beizuwohnen. Alle außer den jungen Kriegern.«
»Wieso? Was ist mit ihnen?«
»Sie haben sich auf Anweisung des Zauberers im Felsental im Norden versammelt. Dort sollen sie sich auf den großen Freudentanz vorbereiten. Er wird beginnen, nachdem der Schatten von dem heiligen Krokodil getötet worden ist.«
Die jungen Krieger des Stammes waren also von den anderen getrennt worden. Das kam Tibor merkwürdig vor. Er hatte ein ungutes Gefühl. Bestimmt ging es nicht nur um den Freudentanz. Führte Umbu noch etwas anderes im Schilde? Tibor verdrängte den Gedanken. Er musste sich sputen, um Kolu zu retten. Bis zum Sonnenuntergang blieben ihm zwei Stunden. Er wandte sich an den Gorilla und schilderte ihm, was er soeben erfahren hatte.
»Bleibe hier und beschütze Bonto, Kerak!«
»Wirst du lange wegbleiben?«
»Hoffentlich nicht. Ich komme zurück, sobald ich Bontos Sohn befreit habe.«
»Sei vorsichtig, Tibor! Die Pfeile der Zweibeiner sind schnell«, warnte Kerak seinen Freund.
»Ich werde daran denken«, versprach Tibor und machte sich auf den Weg.
*
Tibor schwang sich von Ast zu Ast. So kam er viel schneller voran als am Boden. Seit seinen anfänglichen Ausflügen mit Kerak hatte er diese Art der Fortbewegung perfektioniert. Sie war ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Er beherrschte sie so selbstverständlich, wie er früher zu Fuß durch New York gegangen war.
Während er unterwegs zum Fluss war, dachte er über das Verhältnis zwischen Weißen und Schwarzen in Afrika nach. Es war schwer für die Weißen, das Vertrauen der Eingeborenen wiederzugewinnen. Sie hatten sich in der Vergangenheit einige Sünden zuschulden kommen lassen. Nur allzu oft hatte man die Einheimischen mit schönen Worten geködert und sie anschließend ausgeplündert, vertrieben oder sogar getötet. Als man das begangene Unrecht eingesehen hatte, war es fast zu spät gewesen. Die Vorstellung belastete Tibor, der sich als Freund aller Bewohner des schwarzen Kontinents betrachtete, von dem er als Kind und Jugendlicher geträumt hatte. Er hoffte, dass er einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, das verloren gegangene Vertrauen wiederherzustellen. Wenn das gelang, war schon viel gewonnen. Dass er allein die Völkerverständigung nicht erreichen konnte, war ihm klar. Doch wenn andere so dachten wie Major Deakins und er und alle guten Willens waren, ließ sich auf Dauer viel bewerkstelligen.
Er legte den Weg zum Fluss zurück, so schnell es ihm möglich war. Endlich spürte er den Geruch des Wassers in der Nase. Tibor ließ sich von den Bäumen herab und lief die letzten Meter bis zum Waldrand zu Fuß. Hinter einem Baumstamm suchte er Deckung und spähte zum Ufer hinunter.
Eine große Menschenmenge hatte sich versammelt. Tibors Hoffnung, den Jungen befreien zu können, schwand schlagartig. Es war unmöglich, Kolu aus der Mitte der vielen Menschen zu holen. Unter den Anweisungen ihres Zauberers würden sie mit Tibor genauso verfahren, wie sie es mit Bonto getan hatten. Womöglich kämen sie auf die Idee, auch ihn zu opfern.
Aufmerksam beobachtete der Sohn des Dschungels das Geschehen. Ein paar Männer rammten einen Pfahl in das seichte Uferwasser. Wahrscheinlich sollte der Junge daran festgebunden werden. Von dem Krokodil war nichts zu sehen, doch das besagte nichts. Tibor war sicher, dass Umbu genau wusste, was er tat. Wenn er das Krokodil an dieser Stelle des Flusses vermutete, dann war es auch da.
Trotzdem lasse ich nicht zu, dass du dein schmutziges Handwerk zu Ende bringst und den unschuldigen Kolu opferst.
Tibor grübelte und legte sich einen Plan zurecht. Er würde sich im Wasser verborgen halten und das Krokodil töten, sobald es auf sein vermeintliches Opfer zusteuerte. Zunächst einmal musste es ihm jedoch gelingen, unbemerkt in den Fluss zu gelangen. Eine Idee nahm in seinem Kopf Gestalt an. Auf dem Wasser trieben oft Büsche. Diesen Umstand gedachte er sich zunutze zu machen. Er entfernte sich ein Stück vom Opferplatz, wobei er sich in der Nähe des Waldrandes hielt. Hinter einer Flussbiegung grub er einen Busch aus, den er für seine Zwecke für geeignet hielt. Wenn er seinen Kopf in dem Blattwerk verbarg, würde das keinen Verdacht erregen.
Er arbeitete schnell und konzentriert, um keine Zeit zu verlieren. Ein beiläufiger Blick zum Himmel zeigte ihm, dass es bald dunkel werden würde. Zu guter Letzt klopfte er die Erde von dem Busch, damit er im Wasser nicht unterging, sondern an der Oberfläche schwamm. Schließlich nickte Tibor zufrieden. Die Vorbereitungen waren abgeschlossen. Nun kam es darauf an, dass sich in der Praxis umsetzen ließ, was er sich ausgedacht hatte.
Er tastete nach dem Messer, das jetzt wieder in seinem Lendenschurz steckte. Die Waffe würde ihm hoffentlich gute Dienste bei seinem bevorstehenden Kampf leisten. Ohne den von Major Deakins erhaltenen Dolch hatte er gegen ein ausgewachsenes Krokodil kaum eine Chance. Entschlossen schritt er auf das Wasser zu. Hinter der Biegung war er den Blicken der Opferprozession entzogen.
Das Knacken eines trockenen Zweiges alarmierte Tibor. Er fuhr herum, doch hinter ihm hielt sich niemand auf. Ein grimmiges Lächeln huschte über sein Gesicht, und er schüttelte über sich selbst den Kopf. Er wurde schon schreckhaft wie eine alte Jungfer. Mit dem Busch in der Hand ging er weiter.