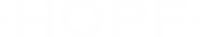Die Löwenaugen der Göttin, der Falkenblick des Kriegsgottes Month und das Starren Ptahs aus der Höhe der doppelt mannsgroßen Steinstatuen trafen den Boten und die Sklaven, als sie aus dem Schatten der Tempelmauern und Palmenkronen traten. Obwohl die Sonne in den Mittag stieg, fühlte Dschai-Anpuhotep einen Hauch von Kälte. Sein Schritt stockte; Schweiß sickerte unter der Perücke in den Nacken. Der Weg führte zwischen den goldstarrenden Schutzgöttern des Herrschers beider Lande hindurch zu einer Terrasse und deren säulengestütztem Eingang. Die Luft war getränkt vom Weihrauchduft und den Ausstrahlungen der Göttlichkeiten. Zwischen den Säulen blieb Dschai-Anpuhotep stehen und bedeutete den Sklaven, zu warten. Ein keckerndes Äffchen aus Punt kletterte an der Statue hinauf, die dünne Bronzekette klirrte am Stein. Die Sklaven stellten große Krüge auf den Sandsteinplatten ab.
Auf der Terrasse standen, unter dem Sonnensegel, eine geflochtene Liege und ein niedriger Tisch. Der Bote näherte sich dem Eingang und wartete, bis seine Augen nicht mehr brannten. Er ging hinein, verbeugte sich und blickte ins runzlige Gesicht des Priesters. »Du bist Merire-Hatchetef, nicht wahr? Man hat mir den Weg beschrieben«, sagte er. »Ich komme von Cha-Osen-Ra, dem Vertrauten des Tatji Ikhernofret.«
Das Licht im unordentlichen Raum war durch Leinenfenster gemildert, und es herrschte mäßige Kühle. Der Priester saß an einer Holzplatte auf Mauersockeln; in zahlreichen Nischen standen und lagen Krüge voller Schreibrollen.
»Ich bin der Tempelschreiber, richtig. Was will Cha-Osen-Ra von mir? Doch nicht etwa einen Rat?«
Merire-Hatchetef winkte Dschai-Anpuhotep näher und kniff die Augen zusammen. Vor ihm standen Wasserkrüglein, ein Becher voller Binsengriffel und gefüllte Tuscheschalen; die Ecken der halb beschriebenen Shafadurolle waren mit Steinwürfelchen beschwert.
»Draußen warten Sklaven«, sagte der Bote leise und schüttelte den Kopf. »Prinzessin Hathor-Iunit und Ikhernofret haben viele Schriftrollen in den Räumen der jungen Halbschwester gefunden.«
»Tama-Hathor-Merit?« Der Priester richtete den Blick aus großen Augen auf Dschai und lächelte. Die Blicke und die Bewegungen der dünnen Finger zeigten, dass der Verstand des Priesters keineswegs so hinfällig war wie der schmale Körper. »Die schöne junge Frau konnte schreiben? Erstaunlich. Weißt du, was sie geschrieben hat?«
Dschai-Anpuhotep zuckte mit den Schultern. Der Brustschmuck klirrte leise. »Ikhernofret und Cha-Osen-Ra bitten dich, die Worte zu lesen. Tamahat, so nannte sie Karidon, hat viel über ihn geschrieben. Die Jahre des Goldhorus sind mit den Fahrten der Bronzehändler schicksalhaft verbunden, sagen Ikhernofret und sein Djadjad. Du füllst viele Rollen über den Großen Chakaura und die guten Jahre des Hapilandes. Vielleicht, sagt Ikhernofret, erhellt die eine oder andere Rolle das Geschehen jener Jahre und macht es den Nachfolgenden besser begreifbar.«
»Sind es viele Rollen?«
»Zwölf solch großer Krüge voll.« Dschai-Anpuhotep deutete auf gemauerte Bänke, überquellende Nischen und Körbe auf dem glänzenden Boden. »Du schreibst selbst, mein Vater?«
»Das meiste. Wenn meine Augen müde werden, hilft mir ein junger Schreiber. Lass die Krüge hereinbringen. Stellt sie dort ab.« Merire wies mit dem Binsengriffel auf eine Steinbank. »Du bist rechtzeitig gekommen. Ihr habt die Shafadurollen früh genug gefunden – noch berichte ich vom Jahr Eins des Goldhorus.«
Dschai-Anpuhotep ging in die Hitze hinaus, winkte den Sklaven und wartete, bis sie den Raum wieder verlassen hatten. Der Priester stemmte sich an der Tischkante hoch und folgte dem Boten auf die Terrasse. Bienen und metallisch leuchtende Fliegen summten in den Weinranken an der Mauer. Das Äffchen hockte auf dem Widderkopf, fraß einen Granatapfel und drehte den Männern das Hinterteil zu.
»Dort hinten, wo Rauch aufsteigt, ist die Küche. Schick einen Sklaven hin; sie sollen kaltes Bier und Wasser und Tücher bringen. Ich danke dir – sag Tatji Ikhernofret, der älter und lederzäher ist als ich, er möge mich besuchen. Wenn es seine kostbare Zeit erlaubt.«
Dschai-Anpuhotep verbeugte sich, legte die Hand auf die Brust; Merire-Hatchetef nickte und verzog die schmalen Lippen. Er sah hinter Dschai her, blickte zum Kanal, zur palmengesäumten Dammstraße und zum neuen Teil des Palasts, dann streckte er sich auf der Liege aus. Er verschränkte die Arme im Nacken und genoss die Hitze, die seine Haut durchdrang und die Knochen wärmte. Nachdem Priesterschüler Wasser, Tücher und Bier gebracht hatten, ging er ins kühle Zimmerchen, blieb unschlüssig vor den wiedergefundenen Binsenmarkrollen stehen und zog, die Schultern zuckend, eine Rolle heraus. Er lehnte sich im knarzenden Stuhl zurück und begann zu lesen; als er den rot geschriebenen Anfang des vierten Kapitelchens erreicht hatte, überzog ein Lächeln ferner Erinnerungen sein Gesicht.
ICH, MERIRE-HATCHETEF, Priester des Ptah, Month und der Sachmet zu Itch-Taui, der das Geheime im Tempel und im Palast kennt, bester Schreiber zwischen den Stromschnellen und dem Großen Grünen, bin vom Herrscher berufen worden, alles niederzuschreiben auf sonnengebleichten Shafadurollen, was sich in der langen Zeit zutrug, über deren bronzenen Jahren der glänzende Name des dritten Chakaura strahlt. Chakauras Vater, der nun in der Sonnenbarke segelt, führte mit seinem prächtigen Goldhorus-Namen die beiden Lande der Rômet zu neuer Größe und Macht, wie es seit Ewigkeiten vor ihm nur wenige Gottherrscher vermochten. Ich schreibe selbst mit zwei Fingern:
Nachdem ich nun zurückgekehrt bin in den kühlen, sicheren Schutz des Großen Tempels, habe ich lange zu den Göttern der Schreibkunst gebetet: Thot in seiner Erscheinung als Pavian und Imhotep als Schreiber blicken aus Mauernischen auf mein Tun. Die rote und schwarze Tusche in den Schälchen, fein angerieben und gemischt, enthält in jedem Tröpfchen – wie meine Erinnerungen, Gefühle und Gedanken – Asche und Schweiß, Goldstaub und Sand, Wasser, Bier und Wein; vermischt und blasig gerührt ist sie mit fernen Echos nächtelanger Gespräche. Der Tau der Wehmut und des Lachens schlugen sich in den Schälchen nieder und das Blut vieler Verwundeter und Toter. Vermengt ist die Tusche mit dem Staub vieler Namen, durch Leid und Lächeln geseiht, Wehgeschrei und Worte fremder Sprachen, funkelnd durch Sternenschein und Mondlicht, durchdrungen vom Glanz der Sonne, Rê-Harachtes Gestirn, und sämig gerührt durch das, was ich weiß und woran ich mich erinnere. Ohne Unrast schreibe ich in der Stille meiner Wohnung über Götter, Menschen und Jahre.
Merire-Hatchetef fuhr über seinen kahlen Schädel, zog die Rolle behutsam auseinander und trug sie hinaus ins letzte Sonnenlicht. Er hielt sie dicht vor die Augen und las blinzelnd, was Prinzessin Tama-Hathor-Merit geschrieben hatte; er murmelte:
»Im milden, weihrauchdurchzogenen Licht deines vierten Jahrzehnts, Priesterschreiber, tut es gut, sich zu erinnern, zu lesen, was die jungen Leute über die wunderbaren Jahre dachten, was sie fühlten. Ach, schönste Tamahat; auch du bist Asche und Staub im Land der Lebenden, und vielleicht begegnet deine Sternenbarke dem Schiff deines Geliebten.« Er kicherte und ließ das rechte Ende des Blattes los. Es drehte sich knisternd nach links zur Rolle zusammen. »Deinem grünäugigen Geliebten meinem Freund, der auch eine gute Handvoll Jahre älter geworden ist.« Das Äffchen kreischte und entleerte wässrigbraunen Darminhalt über die Statue. Merire-Hatchetef senkte den Kopf und murmelte: »O Prinzessin. Es ist schön, was du über ihn schriebst.«
Seine Stimme sank zu einem Murmeln herab, als er weiterlas. »Wenn es wirklich eine Zeit der Wunder werden soll, so ist das Wunder für mich groß und schön. Ein Teil der Macht, die mein göttlicher Bruder mit dem Thronnamen Chakaura in den Händen hält, strömt auch zu mir und durch mich zu anderen Menschen und Dingen. Niemals habe ich einen Mann länger und schärferen Blicks angesehen als den elternlosen Karidon mit den leuchtenden grünen Augen. Er ist schön, obwohl er kein Rômet ist. Stärke, Kraft und Zärtlichkeit sprechen aus jeder Bewegung. Sein Lachen ist der Bruder seiner Kraft. Sein helles braunes Haar ist weich und kurz, seine Wangen glatt und nicht mit struppigen Bart bedeckt wie jene seines polternden Ziehvaters; Klugheit der Rede und Schreibkunst lernte er zusammen mit den Gefährten meines Halbbruders, des Großen Senwosret-Chakaura. Karidon, der mehr fremde Länder und Menschen kennt als wir Rômet, scheint lange zu denken, bevor er spricht, aber seine Küsse und die Erfahrung seiner schlanken Finger erregen mich mehr und tiefer als je ein Mann zuvor. Ich ließ meine Macht sprechen und befahl ihn in den Palast, auf mein Lager; nun zeige ich ihm, was er nie mit anderen Frauen erleben wird. In der Leidenschaft ist er ebenso unermüdlich wie in Stunden des Sturms am Ruder des Schiffes; seine Erzählungen zaubern fremde Inseln in die Langeweile des Palastes und dienen Chakaura dazu, alles über die Feinde jenseits der Grenzen zu erfahren. Wie seine Geschichten, sein Lächeln und der Geruch seines starken Körpers – nach Keftis Sänden, nach dem Schweiß des Schiffes, nach Bilge und langen Nächten auf See, unter den Sternen – füllt sein Begehren, mächtig wie der Apisstier immer und immer wieder mich und meine Nächte aus. Er liebt mich; wenn er von seiner verlorenen, mühsam erstickten Freundschaft erzählt, dunkeln seine Augen wie das Wasser des Großen Grünen im sonnenlosen Sturm: Mein Halbbruder Chakaura, den wir als Jungen Senwosret riefen, ist jener Freund, der nicht Freund sein darf, weil er Gott sein wird. Ich will ihn mit meiner Leidenschaft trösten, den Grünäugigen; mein Herz ist mit Freude gesättigt, wenn wir zusammen sind, es ist wie Wein, seiner Stimme zu lauschen. Ich lebe, weil ich dich und alles, was du aus fremden Ländern berichtest, höre und sehe – was Chakaura nicht darf, ich will und kann es tun; alles.«
Fünfzehn große Öllampen standen entlang der Tischkanten. Ihre Flammen brannten ruhig und grell. Merire-Hatchetef schrieb so sorgfältig wie stets im letzten Jahrzehnt.
Nicht nur das, was ich sah, erlebte und verstand, schreibe ich selbst mit zwei Fingern, sondern auch manches, was mir von Händlern und Freunden, Kriegern und Kush-Sklaven erzählt wurde. Ich habe ihr Vertrauen. Wie es wirklich war, erfuhr und beurteilte jeder anders. Aber mit mir sprachen sie alle, viel später mit ruhigen Worten, jenseits der heißen Erregung der Geschehnisse, denn je älter der Mensch wird, desto genauer erinnert er sich an die Erlebnisse in seiner Jugend, und desto klarer wird seine Rede. Um mich herum, in Mauernischen meiner Tempelkammer, stehen Tonkrüge voller Shafadurollen; mit weißen, roten, grünen oder blauen Bändern, meist einmal, oft zwei oder drei Mal umwunden; manche noch gesiegelt. Nun erst weiß ich, wie ich die Einteilung zu treffen habe, denn alles hängt zusammen: das neue, starke Metall und dessen Händler, der junge Goldhorus Cheperi, der dritte Chakaura also, und dessen unbeugsamer Wille, das Gold von Punt, Kush und Wawat und das wenige kostbare Erz der Sterne.
Von den Grenzen des Hapilandes schrieben meine Freunde mir Briefe; noch mehr schrieb ich an sie, aber viele Schreiben gingen verloren. Göttliche Gesetze, Machtwille und die Pflicht, Wissen zu sammeln für den Herrscher, jugendliche Kraft und der Drang, reich zu werden an Gold und Einfluss, dies trieb die Männer durch zwei Jahrzehnte; durch Stürme, Kämpfe und Sand- und Wasser-Wüsten. Was ich über die Jahre Eins bis Zwanzig weiß, bis zum größten Triumph des Goldhorus über die elenden Nehesi, weiß ich vor den Freunden und Männern unter seinem Thron; vieles über diese Männer, was sie fühlten und ersehnten, wie sie handelten, was sie umhertrieb, was sie glaubten und wem sie die Treue hielten, weiß ich von ihren Frauen.
So beginne ich die Geschichte des Goldhorus, indem ich die seines Freundes Karidon schreibe, der darunter litt, dass Senwosret-Chakaura nicht sein Freund sein durfte, nach dem Willen der Götter; Ptah, Sachmet und Month mögen, wie Thot und Imhotep, mein Tun gnädig betrachten.
1. Tod am Kap Thirr
Dunkelgrün, riesig und mit kochender Gischt gefleckt, rauschte die Woge heran, schlug wie ein Fels gegen das Schiff, riss an den Ruderschäften und prellte die Pinne aus Karidons Fäusten. Das Wasser stieg steuerbords am Heck hoch, bildete eine blasige grüne Wand und brach über Karidon, Jehoumilq und Holx-Amr zusammen. Die Flut, die gegen Hüften und Schultern gischtete, riss die Männer von den Füßen, traf Köpfe und Nacken mit schmerzhaften Schlägen, blendete Karidon und schwemmte über die Planken. Salzwasser biss in den aufgeplatzten Lippen und beim würgenden Atemholen im Rachen. Ehe Karidon den nassen Holzschaft wieder packen konnte, traf ihn der herumwirbelnde Hebel in den Magen. Sein Schrei ging im Heulen des Windes und im Dröhnen des Schiffsrumpfes unter. Die Taue, mit denen er sich festgebunden hatte, schürften die Haut über dem Gürtel auf, die Marter des Salzwassers in den Wunden trieb ihm die Tränen in die Augen. Keuchend holte er Luft.
Jehoumilq und Holx-Amr stemmten sich gegen den Pinnenschaft des Backbordruders. Holx würgte wieder blasigen Schleim hervor, der über sein Kinn lief. Kapitän Jehoumilq zeigte auf den jungen Ruderer, der sich am Mast festklammerte, und brüllte gegen das Mahlen des Nordwinds an:
»Lass los, Rebid! Hinunter mit dir. Die nächste Welle bringt dich um!«
Die Horus der Brandung kämpfte nordöstlich von Kap Thirr gegen Sturm und schweren Seegang. Die blaugrüne Welle, durch die weite Dünungswoge verstärkt, hob das Heck, schüttelte den Rumpf, zerrte und riss an Segel und Mast und schmetterte die bronzeverstärkten Blöcke des Tauwerks klirrend gegeneinander. Der Steuermann würgte und hustete; sein Körper zuckte, aber er ließ die Pinne nicht los und taumelte nur in den Haltetauen. Der Bug der Horus tauchte tief ein, hob sich; weißschäumende Bäche liefen über die hochgezogenen Lukenränder in den Bauch des Schiffes. Rebideka angelte mit der rechten Hand nach einem Tau, das wie eine Peitschenschnur über Deck wirbelte. Jehoumilq drehte den Kopf nach rechts und starrte Karidon an. Obwohl unablässig Gischt, Schauer und Brecher von rechts und links die Männer trafen, schwitzten sie. Jehoumilqs schwarzbehaarter Oberkörper dampfte.
»Das war die erste … Welle«, schrie er und keuchte. »Wenn uns die dritte nicht umbringt, schaffen wir’s bis an irgendeinen verfluchten Strand!«
Vier Stunden zuvor, kurz nach der neunten Stunde, war der Messes aus Nordost über das Meer von Kefti hergefallen. Der kalte Festlandswind türmte riesige Wogen auf, und obwohl die Mannschaft beide Seiten des Segels zur Mitte geklappt und festgezurrt, die Segelfläche um fast zwei Drittel verkleinert hatte, jagte das Schiff ächzend, mit dem Sturm im Heck, durch die Schaumkronen, legte weit nach Steuerbord über, bis die Enden der unteren Rah die Flanken der Wellen furchten. Karidon stand, ebenso wie Holx-Amr, dessen Gesicht fahlgrau war und der sich das Herz aus dem Leibe spie, seit drei Stunden am Ruder. Er sah sich um; der Klumpen der Furcht im Magen wurde größer. Er spreizte die Beine, stemmte sich in die Haltetaue und schrie:
»Achtung! Die zweite Welle! Rebideka …!«
Eine Woge, die von innen heraus zu kochen schien, traf das Schiff, als es endlich den Bug gehoben und sich auf einen Wogenkamm hinaufgequält hatte, in der Mitte des Hecks. Der harte, krachende Schlag erschütterte Deck und Planken. Ein zischender Wasserfall traf die Steuermänner, teilte sich, drückte das Heck unter Wasser, schwemmte an den Seiten der Bordwand zum Mast und flutete gischtend zurück. Plötzliche Helligkeit blendete ihn, schien Jehoumilqs Worte Lügen zu strafen: In den grauen, tiefhängenden Wolken hatte sich ein gezackter Spalt gebildet.
Eine breite Bahn Sonnenlicht schob sich über das Meer und zeigte eine glitzernde Fläche scheinbar niedriger Wellen, von denen der Sturm Schaum und Tropfen waagrecht wegriss; eine endlose Reihe graugrüner Kämme und messerscharfer Kanten, die, wenn Karidon blinzelte, grau wie gemeißelter Schiefer aussahen, mit Lichtfunken auf den Gischtkämmen. Die Pausen zwischen den Brechern, dem schauerlichen Ächzen und Knirschen der Planken und den kalten Wassergüssen waren so kurz, dass jedes Denken unmöglich war.
Der winselnde Messes brachte eisige Luft mit sich; der sonnenhelle Fleck auf dem Meer huschte von Nordost nach Südwest und zeigte, zwei oder drei Atemzüge lang, die Klippen vor Kap Thirr, einen Teil der Inselküste und rechts neben dem Bug die drei Inseln; gischtende Brandung schien Karq, Mynder und Shorph zu verschlingen. Das freundliche Sonnenlicht und die Hoffnungen auf das Abklingen des Sturms nördlich des Kaps erloschen im selben Atemzug; eine steile, fast schwarze Wellenwand raste mit überhängender Spitze heran, als die Horus fast waagrecht durch zischende und prasselnde Wellenkämme schnitt.
»Cabul!« Jehoumilqs heisere Stimme hallte übers Deck, als im Zischen und Jaulen des Sturms eine trügerische Pause eintrat. »Die dritte Welle! Schöpft, Männer! Das Wasser muss aus dem Schiff! Bet zu deinen Göttern, Nedji! Jetzt bringt uns dieses Hurenmeer um …«
Plötzlich fiel Dunkelheit über das Schiff. Das ohrenbetäubende Heulen schnitt jedes Wort ab und erstickte mit lähmender Furcht jeden Gedanken. Wieder versuchte Karidon sich an der Pinne festzuhalten, stemmte die Fußsohlen auf die Planken und lehnte sich in den Haltetauen zurück. Die Horus hob ihre vordere Hälfte aus dem Wasser und schien schneller zu werden. Karidon blickte kurz über die Schulter, duckte sich und schloss die Augen, als die Todeswoge nur noch vier Schritt vom Heck entfernt war. Ihr oberer Teil fegte waagrecht mit vernichtender Wucht vom Heck zum Bug, riss einen Teil der geschnitzten Lotosblüte im Rücken der drei Steuermänner ab und schmetterte ihn gegen Jehoumilqs Schulter. Der Kapitän schrie und fluchte, schüttelte sich und richtete sich wieder auf. Der Wogenkamm gischtete an den Seiten des Rumpfes hoch, beide Wasserwände berührten sich in der Höhe des Mastes, und die Woge lief unter dem Schiff hindurch und hob den langen Rumpf einige Atemzüge lang über Wellen und Gischt, riss, schlug und rüttelte am Bug und ließ die Horus ins Wellental fallen. Karidon knickte in den Knien ein, seine Hände glitten von der Pinne ab, er fiel nach vorn. Das nasse Holz schlug in seine Achseln; er schrie auf. Der Hieb gegen seine Brust hatte ihm den Atem aus den Lungen gepresst; er röchelte, taumelte und stemmte sich, ohne zu denken und zu fühlen, wieder in die Höhe.
»Sie … hat … uns … nicht … umgebracht«, brüllte Jehoumilq. »Mehr nach Backbord, Kari!«
Karidon blickte nach links. Das Gemisch aus Schweiß und Salzwasser rann durch die Brauen in seine Augen. Holx spie noch immer; seltsamerweise stand er aufrechter als der Kapitän und zog an der Ruderpinne. Die Besatzung im Kielraum schöpfte seit zwei, drei Stunden ununterbrochen; dennoch lag die Horus viel zu tief im Wasser. Karidon holte tief Luft. Als er sich umdrehte, glaubte er zu sehen, dass sich das Meer ein wenig beruhigt hatte. Er misstraute, obwohl er nur noch auf ein Ende des mörderischen Seeganges hoffte, dieser Änderung und sah einige Augenblicke lang nach rechts und links Wassergüsse aus den Luken über die Bordwände spritzen.
»Sei verflucht, Großes Grünes.« Holx-Amr hatte seine Stimme halbwegs wiedergefunden. Er röchelte und wischte sich Speichel und Schleim vom Kinn. »Mir ist so übel wie noch nie. Bei Ptah und Month! Warum muss ich das Schiff von diesem wahnsinnigen Jehoumilq steuern?«
»Weil du nichts Besseres kannst, du kotzende Landmaus.« Jehoumilq schien nicht an die Gefahren zu denken. »Und weil du uns nach Kefti bringen willst.«
Ein gischtender Hagel beendete Jehoumilqs Gebrüll. Karidon schwankte; ihm war schlecht. Schmerz tobte unter der Schädeldecke. Seine Lippen schmerzten, der Mund war ausgedörrt, die Augen tränten unaufhörlich. Er ahnte die Klippen, Untiefen und die schrundigen Felswände westlich des Kaps bis zum Strand und glaubte, unter seinen Sohlen zu fühlen, wie Strömung und Sturm das lecke Schiff zur Küste trieben, obwohl er sich ebenso wie Holx und Jehoumilq gegen den Druck des Doppelruders stemmte. Das triefende Segel war seit vier Stunden unverändert prall, der Messes peitschte das Schiff vorwärts, die Höhe der Wellen hatte kaum abgenommen, aber noch war kein Tau gerissen. Ein Omen? Obwohl er sicher war, dass die Horus mitsamt ihrer dreizehnköpfigen Mannschaft niemals die Bucht von Mulal erreichen würde, obwohl er mit anderen Schiffen zwischen der Hapimündung, Gubla und Kefti gesegelt war, ahnte er, dass diese Fahrt im Schiffbruch endete. Das Ausbleiben der Folge mörderischer Wellen und Grundseen in Ufernähe war trügerisch; selbst wenn der Messes nachließ, sogen Wellen und Strömung das Schiff aus Men-nefer, dessen Planken nur zusammengeknotet waren, auf die Felsen zu.
Das Sturmgeheul schien tatsächlich leiser geworden zu sein, denn Karidon hörte das keuchende Würgen des Steuermannes ebenso deutlich wie Jehoumilqs Flüche. Die Krämpfe in seinen Schultern und Oberarmen ließen nach, die Muskeln begannen zu schmerzen. Ununterbrochen schöpfte die Mannschaft Wasser aus der Bilge. Ein gespenstischer Vorgang: Karidon sah gelegentlich einen Kopf oder die Schultern und hoffte, dass die Männer, die zwischen den Planken und Spanten inmitten der Ladung ohne Halt umhergeschleudert wurden, genügend Wasser aus dem Schiff hinausschöpften; es war zu viel, sie würden es nicht schaffen. Karidon war sicher: Die Horus der Brandung ging unter, weit vor der Bucht von Mulal.
»Das Schlimmste ist vorüber«, brüllte Jehoumilq. »Wir schaffen’s noch bis zum Ufer.«
»Vielleicht in Stücken, und wenn wir schwimmen«, schrie jemand aus dem Kielraum. Karidon und Holx-Amr zuckten zusammen, als vom Bug her fast gleichzeitig Knarren und helles Plätschern erklangen. Sie brauchten sich weder mit Worten noch mit entsetzten Blicken zu verständigen. Sie wussten: zwischen den Planken drang Wasser ein. Karidon holte tief Luft und hob den Kopf. Über dem Meer war es ein wenig heller geworden; von Westen brachen durch Wolkenlöcher rötliche Lichtstrahlen über die gezackten Uferhänge und flirrten über die Schaumkämme. Der Sturm hatte die Horus südlich der drei Felseilande vorbeigedrängt. Hinter tief treibendem Uferdunst verbargen sich die steilen Küstenabschnitte ebenso wie die Buchten von Gnos und die Gebirge des Inselinneren.
Idris stemmte sich aus der Luke und kippte einen Ledereimer Wasser über die Bordwand. Er klammerte sich neben Rebideka am Handlauf an und stierte erschöpft Karidon an.
»Da unten schwimmt alles. Lange machen wir’s nicht mehr, Kapitän.«
Jehoumilq blickte ins Leere. Er schien zu rechnen und zu planen. Er nahm eine Hand von der Pinne und wischte über sein Gesicht. Langsam drehte er den Kopf, blickte nach Westen, blinzelte in die grauen Wolken, die über den Himmel jagten, und spuckte röchelnd aus.
»Der Hurenmesses ist vorbei.« Der Kapitän schnäuzte sich und schleuderte den Auswurf über Bord. Larreto kam an Deck und blickte sich um, als sähe er zum ersten Mal ein Schiff. Jehoumilq schrie: »Schaffen wir’s noch bis an Land? Wie sieht’s unten aus?«
»Nach Schiffsuntergang, Jehou!«, rief Larreto. »Wir machen’s nicht mehr lange.«