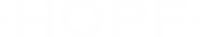1. Zeichen über Men-nefer und Wâset
1. Zeichen über Men-nefer und Wâset
Im Jahr Acht des Herrschers, am dritten Tag des Erntemondes Payni, trieb die Rê-Harachtes Strahlen, gefolgt von zwei Dutzend anderer Schiffe, in weitem Bogen auf die Anlegestelle zu. Jenseits der Ebene aus Wasser, Schwemmland und Schilf erhoben sich Sandschleier, der Tageswind aus Nord blähte das große Rahsegel. Auf den Schiffen funkelten Schmuck und Waffen, im Takt hoben und senkten sich die Riemen; am Hafenbecken schienen alle Bewohner der Stadt zusammengekommen zu sein. An den bunten Häuserfronten, die mit Palmwedeln und Lotosgirlanden geschmückt waren, brachen sich Trommelschläge und der Jubel der Wartenden. Als der Bug des königlichen Schiffes herumschwenkte und der Lotse den Peilstab über dem Kopf schwang, dröhnten und schmetterten Trompetenstöße übers Wasser. Im Deckshaus der Rê-Harachte stand der Goldhorus, Herr beider Lande, Aacheperka-Rê, breitete die Arme aus, und wieder jubelte das Volk.
An der Kante des steinernen Kais standen zwei Pferdegespanne. Bogenschützen und Schildträger bildeten einen Halbkreis und hielten das Volk zurück. Neben dem Gespannführer, einem älteren Mann mit großer Perücke, stand ein schlankes Mädchen, vielleicht sieben, acht Jahre alt. Die Umstehenden klatschten und riefen; sie musste schreien, damit der Lenker sie verstand.
»Heb mich hoch, Amenacht. Ich will meinen Vater sehen!« Ein Bogenschütze hielt die unruhigen Rappen am Zaumzeug. Amenacht lachte, nahm die Prinzessin um die Hüften und stellte ihre Sandalen auf den Handlauf des Wagenkorbes, hielt sie um die Knie. Das Mädchen rief, winkte, lachte; die Umstehenden zeigten auf sie und lächelten. Aber sie hatte nur Augen für das näher kommende Schiff und die Personen im offenen Deckshaus. Amenacht kannte die Prinzessin lange genug; er wusste, dass ihre Freude, den Vater wiederzusehen, nicht einen Wimpernschlag lang gespielt war.
Ihr Vater kam mit viel Beute von einem Kriegszug zurück, auf dem die Chaosu-Nomaden bestraft worden waren. Die Riemen der Steuerbordseite tauchten ins schlammgraue Wasser; das Schiff kam näher; als der Kapitän den Befehl gab, die Rah abzusenken, wehte der Weststurm eine Sandwolke über den Strom; wieder blähte sich das Segel, und das Schiff schwankte. Die Männer auf den Begleitschiffen fluchten. Vom Heck flog ein kieselgefülltes Ledersäckchen zum Kai, an dem eine Lederschnur festgeknotet war; an ihr hing die schwere Schlinge. Hafensklaven fingen das Säckchen auf und zogen an der Leine das dicke Festmachertau zum Land. Das kiellose Schiff schwankte, der Herrscher Aacheperka-Rê hielt sich an den Balken des Deckshauses fest, sein Sohn Djehutjmes stolperte und fiel zwischen die Ruderer, und der ältere Bruder Amenmose schrie einige Befehle.
Der zweite Sturmstoß brachte einen breiten Vorhang staubfeinen Sandes vom gegenüberliegenden Ufer, rüttelte an Doppelmast und Tauwerk, füllte das zusammengefallene Segel und ließ das Schiff weit nach links überlegen. Die Feldzeichen und die goldenen Standarten der Gausymbole schwankten auf den Zedernholzschäften. Der Lotse schleuderte das Fangtau zum Kai; der Lederbeutel schlug gegen den Stein und versank im Wasser, als die Ruderer die Tauschlinge vom Deck wuchteten. Ein Schrei des Entsetzens ging durch die Menge, aber niemand rührte sich. Die federnden Enden der Rah tauchten auf der Backbordseite ins Wasser, das sich unter dem Ansturm des Windes kräuselte. Sandkörner erzeugten auf der stumpfen Fläche Myriaden winziger Ringe. Prinz Djehutjmes klammerte sich an die Ruderschäfte; einige Männer sprangen über Bord.
Langsam versank die halb mannsgroße Tauschlinge im Hapi. Die Prinzessin rief zornig: »Warum tut keiner, was nötig ist?«
Soldaten, Hafensklaven und Stadtbewohner wurden unruhig, aber niemand tat etwas. Hushpeswa stützte sich ungeduldig auf Amenachts Schultern, streckte dann die Arme über den Kopf und sprang im flachen Bogen vom Wagenkorb ins Hafenwasser und tauchte. Einige Atemzüge lang verschwand der Körper im dunklen Wasser, kam an die Oberfläche, schwamm mit wilden Schlägen auf die Tauschlinge zu. Die Prinzessin rammte den linken Arm durch die Öffnung. Im gleichen Augenblick rannte auf dem krängenden Schiff ein Bogenschütze mit langen Schritten zum Bug, stieß den Lotsen zur Seite und stürzte sich wie ein jagender Eisvogel ins braune Wasser, schwamm auf Hushpeswa zu. Sie warf sich im Wasser herum und glitt auf die schmalen Steinstufen zu, die von der bemoosten Schmutzlinie des Niedrigwassers zur Oberkante führten. Endlich kam Bewegung in die Hafenarbeiter und Gardisten. Sie griffen nach der Prinzessin, packten die Schlinge und stemmten sich gegen das armdicke nasse Tau, zerrten und zogen, vorbei an den scheuenden Pferden: endlich fiel die Schlinge um die Steinsäule. Bogenschütze Senenmut zog sich in die Höhe und blieb atemlos neben dem steinernen Poller stehen. Die Ruderer zogen das Tau straff, das Schiff richtete sich schwankend auf, das Ende des Segels hob sich tropfend aus dem Wasser. Gerade kam die Prinzessin triefend die Stufen herauf. Ihr Kinderzopf hatte sich gelöst, das Haar klebte über dem rechten Ohr bis zur Schulter. Amenacht stolperte heran und zog sie zum Wagen.
»Du hast dich in Gefahr gebracht, Hushpeswa.« Er war schweißgebadet, sein Gesicht war aschfahl. »Warum tust du das, Prinzessin?«
Sie antwortete nicht und sah sich mit großen Augen um. Senenmut lächelte ihr zu und hob den Arm; der Kapitän brüllte Befehle.
Als sei Hushpeswas Sprung ein Zeichen gewesen, zogen Hafenarbeiter das Schiff gleichmäßig mit Heck und Bug an den Kai, während der aufkommende Sturm bräunliche Sandwolken durch die Luft peitschte. Aacheperka-Rê deutete auf die Prinzessin und rief durch das aufgeregte Murmeln und den heulenden Wind: »Meine Tochter Hushpeswa! Im rechten Atemzug hat sie das Tau gepackt, hat das Richtige getan! Nehmt euch ein Beispiel, ihr anderen!« Er winkte Senenmut. »Und du auch. Danke, Bogenschütze!«
Die Bordwand schabte und scheuerte am Stein, die Ruderer hatten vergessen, die Prallsäcke auszuhängen. Die Laufplanke krachte auf die Quader. Hushpeswa drängte sich vor Amose durch die Menge, rannte aufs Schiff, sprang zum Deckshaus hinauf und breitete, ebenso wie Aacheperka-Rê, die Arme aus. Ihr Vater umarmte sie, hob sie hoch und lachte blinzelnd; Sand wehte schmerzhaft in ihre Augen.
»Die einzige, die erkannt hat, was nottut!« Kapitän, Steuermänner, Lotse und die Mannschaft, die das Segel befestigte, schienen sich unter seinen lauten Worten zu ducken. »Meine Tochter, ein siebenjähriges Mädchen! Wir waren siegreich und wären fast ertrunken – komm, geh’n wir ins Haus. Der Sturm hört nicht so schnell auf.«
Er nickte den Prinzen Djehutjmes und Amenmose zu, nahm Hushpeswas Hand und zog sie zur Planke. Hushpeswa hängte sich an seinen Arm und sah lachend zu ihm auf. Vor ihnen öffnete sich eine breite Gasse bis zum kleinen Stadtpalast. Die Wartenden warfen sich zu Boden; wieder heulte der Sturm, Staub und Sand über Hafen, Stadt und Palmen wirbelnd. Der Herrscher beachtete die Kauernden nicht und rief: »Es ist schön, dass ihr mir entgegengefahren seid, Amenacht! Wenn ihr nicht gekommen wärt, würde der Herr beider Länder vielleicht ertrunken sein. Oder Sobeks Geschöpfe hätten ihn zerfleischt.«
Seine Fröhlichkeit steckte Hushpeswa an. Sie hatte die Sandalen verloren und hüpfte neben ihm her, umklammerte seine Hand, mit der anderen wischte sie das Wasser aus ihrer schwarzen Haarsträhne. Hinter ihnen verschluckte das Heulen des Sturms die Flüche des Kapitäns und das Klappern der langen Riemen.
Spät am Abend, als sich der Sandsturm vorübergehend gelegt hatte, gähnte Aacheperka-Rê, blies ein Öllämpchen aus und sagte: »Alter Freund Amenacht, Vorsteher und Hüter der Gespanne. Ist es nicht ein seltsames Zeichen? Ich habe stundenlang darüber nachgedacht.«
»Was meinst du, Herr?« Amenacht hob die Schultern; sein Gesichtsausdruck bewies, dass er keinen Tadel erwartete. »Zeichen? Der Sturm?«
»Ich meine nicht den Sturm. Hushpeswa.« Der Herrscher schüttelte den schmalen Kopf. »Meine Tochter. Sie ist wirklich so viel wert wie zwei Söhne. Als einzige springt sie ins Wasser und zerrt das Tau an Land. Sie weiß genau, was zu tun ist, nicht wahr?«
»Ich hab sie festhalten wollen.« Amenacht lächelte verloren. »Sie hat mich ans Kinn getreten und ist gesprungen. Sie schwimmt wie ein Fisch, deine Tochter, Herr.«
»Und sie denkt schneller als wir alle.« Aacheperka-Rê kratzte mit dem Nagel des Zeigefingers einen Essensrest aus den Zähnen. »Fast so schnell war Senenmut. Meine Söhne haben sich erschreckt festgeklammert.« Er kicherte. »Und Djehutjmes ist in die Bilge geplumpst wie ein Bund reifer Datteln. Wie gut, dass …«
Er hob den Kopf, starrte ins Gesicht des Freundes, schlang die Hände um die Schultergelenke, als ob er fröstle, dann schüttelte er sich. Der Herrscher schien zu überlegen, ob er seine Gedanken dem alten Kampfgefährten gegenüber aussprechen könne. Er drehte die Schale auf dem Tisch. Das Knirschen biss in den Ohren der Männer. Aacheperka-Rê brummte: »Prinz Amenmose, der ältere Sohn, Vorsteher der Streitwagen und somit dein Vorgesetzter, guter Amenacht; ihn sähe ich gern in zwei Handvoll Jahren auf dem Thron. Dann könnte ich ruhig sterben. Der Kleine? Djehutjmes? Ich weiß nicht. Hoffentlich verbergen sich Stärke, Klugheit, Fleiß und herrscherliche Art noch im dunklen Schoß seiner Kindheit.« Er hielt die Hand vor den Mund und rülpste. »Oder? Was sagst du?«
Amenacht atmete tief ein, hob die halbleere Schale und sagte leise: »Da deine Herrlichkeit morgen das meiste von dem vergessen haben wird, was wir beim guten Henket bereden, wage ich es auszusprechen.«
»Sprich, Freund: dreimal hast du den Schild vor mich gehalten, sonst wäre ich tot oder weitaus hinfälliger. Meine Göttlichkeit wird erst morgen im Tempel wieder zutage treten. Noch mehr Henket?«
»Kein Bier mehr. Ich muss fahren; lenken, auf deine wilde Tochter aufpassen. Ich … wenn deine Tochter, o Herr beider Länder, ein Mann wäre, würde ganz Tameri tausend Jahre lang mit dem Jubeln nicht mehr aufhören. Wir werden zusehen, wie sie Jahr um Jahr schöner, klüger und stärker wird.«
»Und älter. Leider. Wie wir, Amenacht.« Aacheperka-Rê leerte die Tonschale und warf sie über die Schulter, ohne zusammenzuzucken, als sie klirrend barst. »Nun. Sie ist eine Frau, kein Mann; nirgendwo steht bislang geschrieben, dass Frauen auf dem Thron etwas bewirkt hätten, das aufzuschreiben wert gewesen wäre.«
Er stand auf und umklammerte beide Armlehnen. Er grinste in Amenachts Gesicht und hob die Schultern; der Oberste aller königlichen Gespanne trat drei Schritt zur Seite und sagte: »Vielleicht erinnerst du dich dieser trunkenen Nacht, erhabener Spross der Göttlichkeiten. Erinnere dich dann auch daran, dass du selbst gesagt hast, dass die Bewahrung des Wichtigen, des Althergebrachten, in Wirklichkeit aus tausend winzigen Änderungen besteht.«
»Darüber heute zu reden, o Kenner von neunzehn Sorten Henket, würde bedeuten, Netze aus Wasserstrahlen zu knoten. Schlafe tief, gut und lange.«
Er hieb Amenacht die Hand auf die Schulter, ging zum Schlafraum und fluchte lautstark, als er über eine Kopfstütze des Ruhebettes stolperte. Amenacht rieb die Schulter und ging in den Garten, rollte sich in seinen Mantel und erinnerte sich morgens an wohlige Träume.
Fast drei Monde später, im Erntemond Pachons, kurz nach dem Anbruch der Abenddämmerung, setzte sich Hapu auf die oberste Stufe der Treppe, lehnte sich gegen den heißen Stein und betrachtete den Mond. Die einundzwanzigste Nacht begann, in der das Gestirn, tiefgelb leuchtend, sich hinter weißem, scheibenförmigem Dunst versteckte. Der ferne Nebel war entstanden, als die Sichel sich zu füllen begann. Der Oberste Deuter der Götter musterte die Narben auf der kupferfarbigen Scheibe; auch heute wuchs seine Unruhe. Der strahlende Nebelschleier der Götter teilte den Himmel. Hapu stand ächzend auf, ging quer über das Tempeldach und blieb, während die Nacht über Wâset fiel, zwischen den Säulen des Altarhäuschens stehen. Er hielt stumme Zwiesprache mit dem Gestirn des Thot; weder in den Aufzeichnungen des Tempels noch in den Erinnerungen der Priester, die viel älter waren als er, ließen sich Deutungen finden. Die Götter schwiegen, oder war er nur zu ungeschickt, das Zeichen zu erkennen?
»Thot! Amûn! Helft mir«, flüsterte er. »Ein gutes oder schlimmes Zeichen? Für oder gegen die Herrschaft des Goldhorus im Per-Ao?«
Der Schleier um den vollen Mond schien dichter zu werden. Tausende Rômet in der Stadt blickten ebenso wie Hapu in die Finsternis der gestirnten Nacht. Obwohl er über das Wissen aus Erinnerungen und Vergangenheit verfügte und in den Listen guter und misslicher Tage gelesen hatte, war er nicht klüger als sie: Was sollte er sagen, wenn Aacheperka-Rê fragte? Er setzte die Ellbogen auf die Knie, stützte sein Gesicht in die Handflächen und sah zu, wie der Mond und dessen molkiger Hof ihre Wanderung fortsetzten. Manchmal irrte sein Blick ab und glitt über die Stadt und das Umland, die unter dem fahlen Vollmondlicht erstarrt dalagen.
Der Hauptlauf des Stroms führte nach Nordosten, und das Fruchtland war zwischen der Wüste und dem Gebirge aus Kalkstein an keiner Stelle breiter als zwanzig Chen-Nub. Das östliche Hapiufer, von Dämmen geschützt, durch die Kanäle zu Hafenanlagen und Überschwemmungsteichen führten, erstreckte sich zwischen Madu und dem weiter stromauf wachsenden Ipet-Resit-Tempel der Göttin Mut; eine veränderliche Landschaft aus Dutzenden Nebenarmen, Altsümpfen und Totwassern zwischen breiten Schilfgürteln. Die Stadt Wâset – auch Wese und No-Amûn genannt –, Hauptstadt des Zeptergaus im Land der Biene, uralt, erst seit den Königen Amenemhet und Chakaura mehr als eine unbedeutende Siedlung, hatten die Herrscher Neb-Pachti-Rê und Dshesher-Ka-Rê nach der Vertreibung der Heka-Chasut zum Mittelpunkt der Verwaltung beider Lande gemacht. Wâset und Men-nefer, die größten Städte Tameris, erstreckten sich längs des Stroms und westlich des Hauptarms.
Der Palast, die Gebäude der Großen Königlichen Gemahlin – Säle, Kammern, Terrassen und weitläufige Gärten – gruppierten sich hinter Flutmauern um den kleineren Hafen; der unregelmäßige Ring der Stadt gliederte sich in unzählige Vierecke und Dreiecke; weiße, braune, gelbe und rote Mauerflächen, Treppen und Rampen, in Gassen und Plätze, in rußige Schattenflächen und einzelne Bäume: Sykomoren, Dattelpalmen, Tamarisken oder Nusspalmen. Jenseits der Häuser und Werkstätten der Handwerker zeichneten Felder, Weiden und Äcker Vierecke und Rechtecke in den Boden des Landes, bis zur Grenze der Wüste und über die Niederung des Stroms hinweg zum Fuß der westlichen Berge. Hapu, »Größter der Schauenden«, glaubte, die Erregung der Menschen spüren zu können; zu viele Nächte lang drohte der Kupfermond hinter der runden Wolke; seit fast dreißig Tagen bewegte sich Horus der Rote drohend und lautlos zwischen den weißen Sternen; noch nie, sagten die Priester, war er so klar und rot strahlend zu sehen gewesen.
Hapu nahm die Hände von den Augen und sah zum Himmel. Was er in den Sternen sah, hatte zweifellos mehr Bedeutung, als die »Stundenpriester« zu erkennen glaubten. Der Priester fröstelte; er ahnte die Bedeutung nicht einmal, und er fürchtete sich vor dem Undeutbaren.
Seltsam aufgeregte Laute und Geräusche drangen aus der Stadt heran. Hapuseneb gähnte, rieb seine Augen und starrte den Mond an: es war Mittnacht. Der Nebel um das Gestirn des Thot hatte sich nach zwanzigeinhalb Nächten spurenlos aufgelöst.
Eine Stunde nach dem höchsten Stand der Sonnenscheibe ballte sich jenseits des Horns, wie die tausend Ellen hohe Bergspitze genannt wurde, eine graue Wolke zusammen. Sie dehnte sich aus, wuchs in die Höhe und änderte, als sie die Sonnenscheibe erreichte, ihre Farbe in bläuliches Schwarz. Sturmböen wirbelten plötzlich kreiselnde Sandsäulen aus der Wüste heran; sie tanzten über den Bergkamm, faserten auseinander und prasselten in die Täler.
Zuerst dachten die Fischer und die Bewohner Wâsets an einen Sandsturm; ihr Schrecken nahm zu, als die Priester sagten, es sei eine Wolke voller Wasser. Nur die Bewohner der Küste des Großen Grünen kannten diese überaus seltene Erscheinung; in Wâset gab es nur einige Greise, die sich an Regen über diesem Teil des Landes zu erinnern vermochten. Westwind schob die Wolke über das Gebirge, die Sonne wurde zu einer bronzefarbenen, später zu einer weißgrauen, kleinen Scheibe, Halbdunkel legte sich über Stadt und Strom. Die Tiere verkrochen sich, kreischende Vogelschwärme fielen zusammen mit Sandwolken ins Schilf ein, die Rômet flüchteten in die Häuser. Ein gewaltiger, vielfach verzweigter Blitz verband Erde und Himmel und tauchte die Stadt, das Fruchtland und die Umgebung in kreideweiße Helligkeit. Unmittelbar danach, als das Poltern auseinandergesprengter Felsen zu hören war, ertönte ein scharfes Krachen, laut genug, um Menschen und Tiere taub zu machen.
Die ersten Tropfen fielen fast senkrecht, hart wie Kiesel, schlugen im Sand kleine Trichter, bildeten dunkle Flecken auf den Lehmziegelmauern, und die niedrige Wolke verschluckte Rê-Harachtes Gestirn. Regen rauschte herunter, spülte Staub und Sand von den Gewächsen, beugte das Schilf und sickerte in Dächer, Mauern und Wände, sammelte sich in Pfützen und ließ die Farbe in breiten Streifen von den Mauern ablaufen. Drei furchtbare Schläge donnerten in der Luft und fuhren über das Land hinweg; der Regen strömte über die Felsen des Gebirges, verwandelte die Oberfläche des Hapi in schwärzliche Muster und die Sandflächen in gelben Brei, der durch die Gassen lief, Unrat mit sich schwemmte und stank.
Ein Dutzend Atemzüge lang ratterten Hagelkörner herunter. Die Nässe fraß sich in trockene Mauern, machte sie mürbe und weichte Lehmziegel, die im Sand trocknen sollten, zu formlosen Schlammhaufen auf. Die Wolke zog über Wâset, mehr als eine Stunde lang, näherte sich mit prasselnder Flut der östlichen Wüste; ihrem Schatten folgte vom nassen Gebirge her greller Sonnenglanz; die Wolke zerfiel in einzelne Arme. Schilfwälder und Kornfelder dampften wie die Berghänge. Alle Bilder verschwammen vor den Augen, eine Woge feuchter Hitze brach sich zwischen den Häusern; viele Mauern waren zusammengesackt, Brüstungen lagen in den Gassen und Gärten, und die Stadt schien nur noch aus unfertigen und beschädigten Bauwerken zu bestehen. Vom Heiligen Teich der Tempel bis weit hinaus in die Wüste krümmte sich ein strahlender Regenbogen, dessen Farben langsam im blauen Himmel verblichen. Am Beginn der Jahreszeit Schemu, vor der Haupternte, im Jahr Fünf des göttlichen Herrschers Aacheperka-Rê begannen fünfzehntausend Rômet die Schäden auszubessern. Die Priester des Amûntempels kamen zusammen, lasen in den Annalen, berieten und befragten die Götter, um herauszufinden, was diese unbekannten Zeichen bedeuteten. Sie fanden keine Erklärungen, bekamen keine Antworten und schauderten; Sachmets Zorn schien über Wâset gefallen zu sein.