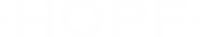5. (16). November 1796, morgens acht Uhr dreißig. Wieder kroch ein sonnenloser Morgen herauf, wieder begann ein grauer Novembertag, der fünfte dieses kalten Monats. Eine Nebelschicht, aus der reglos kahle Bäume und blattloses Buschwerk hervorragten, lag über dem Schnee, bis hinunter zum Meer. Die Fundamente der Häuser schienen in einem gefrorenen See zu stehen. Die Sonne blieb eine Welle ein glimmender Fleck am Horizont, bis das Grau aufriss; vor dem Streifen leuchtend blauen Himmels streckten sich waagrechte Schatten bis zu den Mauern des Winterpalasts von Zarskoje Selo. Ein einzigartiges Licht fiel über den Ort, eine kurze, irisierende Helligkeit, wie der Regenbogen aus geheimnisvollen Farben und Empfindungen zusammengesetzt. Die Eiszapfen an den Schlagläden begannen zu glänzen, als schmölze sie warmer Wind. Das Licht zeichnete Streifenmuster in die Vorhänge und auf die Bespannung der Wand. Die Helligkeit teilte die Bilder in spiegelnde und matte Hälften und schuf jähen Glanz auf dem Gold und Silber der Rahmen und der Leuchter. Der Tag begann still, kaum war das Ticken der Uhr zu hören. Jekaterina hob, noch halb im Schlaf, die Hand an die Augen und verließ widerwillig die Leichtigkeit des Traums und dessen Sinnlichkeit, die er auch heute in der Stunde vor dem Erwachen geweckt hatte.
Die Bespannung unter dem Laken knarrte in der Ruhe des Schlafgemachs. Ein Rest Wärme und die gewohnten Schlafgerüche hatten sich zwischen den Vorhängen und dem Baldachin des Betts gesammelt. Es roch nach kaltem Rauch. Jekaterina öffnete die Augen, blinzelte und versuchte sich an den Traum des tiefen, langen Schlafs zu entsinnen. Eine fröhliche Plauderei war darin vorgekommen, der schweißnasse Körper eines jungen, gesichtslosen Mannes, der über ihr zuckte, und sie entsann sich seines Keuchens und einer riesigen weißen Fläche, auf der sie mit kratzender Goldfeder geschrieben hatte. Sie erinnerte sich weder an den Inhalt noch an den Empfänger ihres Traumbriefs, aber sie lächelte. Als sie das Knarren der Tür und die leichten Schritte der Hofdame hörte, drehte sie den Kopf und sah, wie die Lichtflut im Schlafgemach versiegte und vom schattenlosen Grau des Tages abgelöst wurde. Eine Uhr schlug mit zirpendem Silberklang.
»Guten Morgen, Eure Majestät.« Jekaterina schmeckte den Geruch frisch gebrühten, starken Kaffees und das Duftwasser, das zusammen mit dem Ruch kalten Schweißes aus den Kleidern der Madame Perekusikina dünstete. »Ihr habt tief und gut geschlafen. Ich hab Euch nicht geweckt.«
Jekaterina richtete sich auf. Jede Bewegung fiel ihr heute unerwartet leicht. Es war, als hätte ihr schwerer Körper in den neun oder zehn zurückliegenden Stunden Schlaf mehr Kraft schöpfen können als in vielen anderen Nächten.
»Ich war schon wach.« Das Kaffeegeschirr klirrte auf dem niedrigen Tischchen, die schwarze Brühe gluckerte in die Tasse. Jekaterina gähnte und rieb sich die Augen. Auf der Zunge und dem Gaumen spürte sie sauren Speichel. »Es war ein guter Schlaf, endlich wieder einmal. Ich fühle mich, als wäre ich zwanzig Jahre jünger.«
Im Nebenzimmer lärmte ein Diener auf den Rosten des Kachelofens, ein anderer legte Holzkohle auf die Glut unter einem Samowar. Als die Kaiserin die Tasse hob, waren ihre Finger ruhig wie die einer Vierzigjährigen. Die Hofdame winkte der Kammerzofe, die schweigend den weißseidenen Morgenmantel am Fußende des Betts ausbreitete. Jekaterina rührte bedächtig Zucker in das Morgengebräu und erwartete die süße Hitze des ersten Schlucks, der den Nachtbelag ihrer Zunge und des Munds vertreiben würde.
Sie blickte, während sie trank, im Schlafraum umher, setzte die Tasse ab und schob einige Haarsträhnen unter die Schlafhaube zurück. Die Dienerin ersetzte heruntergebrannte Kerzen, brach herabgetropftes hartes Wachs ab und entzündete nacheinander zwei Dutzend weiße Dochte. Das Halbdunkel, das die Kaiserin bedrückte, wich den Inseln gelben Lichts, das um die Leuchter waberte. Jekaterina hob das zweite Tässchen und spürte die Schläge ihres Herzens bis in die Schläfen; es schien doppelt stark und schnell zu schlagen als während des Anfalls, der sie heimgesucht hatte.
Sie erinnerte sich an den lautlosen Schlag, der sie vor acht Wochen halb gelähmt hatte; ihr Körper hatte ihn überstanden, ebenso schnell wie jede andere Krankheit. Sie holte tief Luft, schlüpfte in die goldbestickten Pantoffeln und richtete sich auf, die Tasse in den Fingern der rechten Hand.
»Und weil ich mich kräftig, stark und jung fühle«, sagte sie und betrachtete die Flämmchen der Kerzen, »werde ich im Frühling zur Krim reisen, wenn alle Straßen wieder aufgetrocknet sind.«
»Sehr wohl, Eure Majestät«, entgegnete die Hofdame und beugte lächelnd das Knie. »Und wenn man die Brücken wiederhergestellt hat. Das Volk wird Euch zujubeln, so wie es immer entlang Eurer Wege Beifall spendet.«
Kaiserin Jekaterina leerte die Tasse. Der Kaffee rann heiß durch den empfindungslosen Mund, über die pelzige Zunge, durch ihre Kehle, erweckte ihre Lebensgeister, schien ihren Magen zu füllen und vertrieb die Gedanken an Alter, Hinfälligkeit und winterliche Kälte, und im Fell der Pantoffeln begannen sich die Zehen zu wärmen. Die Kaiserin, in wohliger Benommenheit, ließ sich den Morgenmantel umlegen, spürte die Seide auf der Haut, schloss die Knöpfe und stand auf. Madame Perekusikina und die Dienerin senkten die Köpfe, als sie an ihnen vorbeiging. Für einen kurzen Augenblick öffnete die Dienerin ein Fenster, und eisige Luft drang herein. Vor der Kaiserin verließen die Frauen das Schlafzimmer und schlossen leise die Tür.
Jekaterina reinigte und kühlte ihr Gesicht mit einem Stück Eis und trocknete es ab. Dann ging sie mit schwerem Schritt durch den leeren Arbeitsraum, setzte sich an den Tisch und benutzte den Fächer, bis die Brille wieder klar war; ihr Atem hatte die Gläser beschlagen lassen. Sie fing an, den Bericht über den Einmarsch eines französischen Heeres in Italien zu lesen. Am Abend jedoch hatte sie von einem Sieg der Österreicher gehört, und so nahm sie einen leeren Bogen, tauchte die Feder ein und begann nach kurzem Zögern einen Brief. Als sie die erste Zelle beendet hatte, legte sie die Hand unter die linke Brust und wartete, bis unter der Berührung der harte Herzschlag und die Stiche aufhörten. Sie las: »… beeile mich, Ihrer exzellenten Exzellenz zu verkünden, dass die exzellenten Truppen Ihres exzellenten Landes die Franzosen tüchtig verprügelt haben …«
Vor der Ikone der Muttergottes von Kasan brannte eine frische Kerze. Jekaterina löste den Blick von dem goldumsäumten Antlitz der Madonna, als Platon Subow den ungeheizten Raum betrat. Er war rasiert, roch nach teurer Seife und schien lange und gut geschlafen zu haben. »Was schreibst du, Imperatritsa?« Jekaterina lächelte und legte ihre Hand auf Subows Finger, die ihre Schulter streichelten.
»An Graf Cobenzl. Etwas Scherzhaftes, mein Freund«, sagte sie leise. »Dem Gesandten aus Wien. Ich gratuliere ihm zum Sieg der Österreicher.«
Subow nickte. »Das ist vielleicht etwas voreilig, aber … ich werde die Schreiber hereinschicken, ja?« »Sie sollen noch ein paar Minuten warten.« Sie sah dem Dreißigjährigen nach, der mit kraftvollen Schritten und klirrenden Sporen den Raum durchquerte und leise die Tür schloss. Aber auch Subow war älter und schwerer geworden. Köstliche, beneidenswerte Jugend!, dachte sie und hob das Vergrößerungsglas ans Auge. Die Kerzenflamme zitterte in der Zugluft. Weniger als eine Stunde später, nachdem die Hofdame frischen Kaffee auf dem Arbeitstisch serviert hatte, war Jekaterina wieder allein und ging ins Schlafgemach zurück.
Durch eine schmale Tür betrat der Kammerdiener Sotow den Arbeitsraum. Sein Gesicht unter der weißen Perücke drückte Missmut aus und, wie meist um diese frühe Zeit, die Erwartung unbestimmbaren Unheils; er blickte sich um und nickte kurz. Die Hofdame und die Dienerin sahen ihn schweigend den Raum verlassen.
Die Kaiserin schloss die Tür des Toilettenkabinetts, raffte Nachthemd und Morgenmantel und setzte sich. Zwischen juwelenumrandeten Spiegeln, goldenen Kämmen und Bürsten, Kristallfläschchen, duftenden Seifenstückchen, mit preußischer Akkuratesse gefalteten Handtüchern und einem Dutzend juwelenverzierter Döschen lag auf einem weißen Seidenkissen eines ihrer Vergrößerungsgläser aus Silber und Porzellan. Jekaterina griff nach einem Buch, zwischen dessen Seiten ein goldbesticktes Bändchen funkelte, hob es vor ihre Augen und begann zu lesen; sie wusste, dass sie zu dieser Stunde nur bedeutungslose Teile des Inhalts zu begreifen imstande war.
Einige Minuten vergingen, zehn, fünfzehn oder mehr.
Sie begann ungeduldig zu werden und warf einen Blick auf die dicken Knie und die faltige, mit Altersflecken übersäte Haut der Oberschenkel. Als die Buchstaben vor ihren Augen verschwammen, und während sie ihre Gesäßmuskeln spannte, durchzuckte ihren Körper wie ein kalter Blitz ein lähmender Schlag.
Unter der Schädeldecke schien ein mehrfaches Knacken, scharf wie Stahlklingen, ins Bewusstsein zu dringen. Schwärze und schmerzlose Leere brandeten gegen ihre erblindenden Augen. In wirren Schleifen und Verknotungen löste sich ihr Denken und Fühlen auf; ihren Händen entfiel das Buch und klappte auf ihren Knien zusammen. Sie kippte, ohne es zu spüren, seitlich vom Sitz. Ihre Stirn schlug gegen die Wand des Kabinetts, ihre Finger rissen ein Tuch von der silbernen Stange.
Ein letzter Gedanke, dünn wie ein federnder Spinnenfaden, zuckte ihr durch den Kopf. Ich will nicht sterben! Ich hab noch so viel zu tun! Es kann nicht das Ende sein! Nicht so! Niemand herrscht besser über das Land als ich!
Eine dumpfe Woge schwemmte über sie hinweg und löschte ihr gesamtes bewusstes Leben aus: Bilder und Geräusche, Gerüche und Empfindungen, das Tasten der ziellos zitternden Finger und die Feuchte in der Tiefe ihres Schoßes einziges Überbleibsel ihres letzten Traums.
Der Kammerdiener und die Hofdame Perekusikina wechselten einen langen Blick. Sotow kratzte sich unter der Perücke und sah auf die Uhr. Gewöhnlich läutete die Kaiserin täglich vor neun nach ihm. Er zuckte mit den Schultern, wartete eine Weile und klopfte zögernd an die Tür des Schlafgemachs.
»Keine Antwort, Sotow?«, sagte die Kammerzofe, ebenso ratlos wie er. Sotow klopfte ein zweites Mal, stärker. Als er einige Atemzüge lang vergeblich auf eine Antwort der Kaiserin gewartet hatte, drückte er die Klinke hinunter und betrat den Raum. Ein einziger Blick zeigte ihm, dass er leer war. Der Geruch von Jekaterinas Duftwasser hing in der brackigen, kalten Luft. Sotow rief die Hofdame und rannte zur Tür, die den Gang zum Toilettenkabinett verschloss. Er klopfte, wartete, riss sie auf, blieb erschrocken stehen, begann einen Fluch und schlug die Hand vor den Mund.
Kaiserin Jekaterina lag neben dem Sitz auf dem Boden, Nachthemd und Morgenmantel in wirren Falten um ihre Füße, die Haube halb heruntergerutscht. Ihr Gesicht war blutrot. Sotow brüllte nach Hilfe, schrie nach Platon Subow und Doktor Rogerson, die Hofdame begann schrille Entsetzensschreie auszustoßen. Unruhe und Aufregung breiteten sich im Inneren des Winterpalasts aus, blitzschnell, wie die Bruchstücke eines explodierenden Schrapnells. Durch den Korridor und aus einigen Zimmern stürzten Menschen hervor. Türen schlugen gegen die Wand, ein Hund bellte wie rasend, die Vögel im Käfig aus Golddraht hüpften und flatterten zwitschernd gegen die Gitter und Sitzstangen.
Vier Männer schleppten den zuckenden Körper aus dem Nebengelass; in der Enge des Raums behinderten sie sich gegenseitig. Der Körper war zu schwer und zu unbeweglich, um auf das Bett gehoben werden zu können. Sotow breitete ein Laken über eine Ledermatratze, die einige Diener heranzerrten und neben dem Prunkbett zu Boden fallen ließen. Die Kaiserin rang röchelnd nach Luft, ihre Augen waren geschlossen, ihr Körper zitterte und zuckte.
»Die Ärzte! Holt sie, schnell!«, kreischte eine Dienerin.
Die Hofdame, deren Stimme zu versagen drohte, schickte Pagen zum Hauptmann der Palastgarde. Ein Bote sollte Großfürst Alexander holen, ein anderer mit der schrecklichen Nachricht zu Thronfolger Paul Petrowitsch reiten, der sich auf seinem Gut in Gatschina aufhielt, einen halben scharfen Tagesritt von Zarskoje Selo und vom Winterpalast entfernt. Einige Minuten vergingen, dann stürzten die Ärzte ins Schlafgemach und berieten sich aufgeregt; die Achtundsechzigjährige war ohne Bewusstsein nach ihrem zweiten, schweren Schlaganfall.
»Man muss ihren Leibarzt holen«, rief der Kammerdiener. »Und wo ist Subow?«
»Ich bin hier«, sagte der Adjutant der Kaiserin. »Wie kann ich helfen?«
Platon Subow schob sich zwischen Kammerfrauen und Ärzten bis zum Rand der Matratze und kniete sich neben die Zarin. Der alte Kammerdiener redete wild auf ihn ein und wiederholte ständig »Aderlass! Aderlass! Ein Schlaganfall!«
Zwei Dutzend Bedienstete umstanden im dichten Kreis die Ledermatratze, mit aufgerissenen Augen, angstvollen Gesichtern und unfähig, etwas Sinnvolles zu tun. Die Ärzte zogen, zerrten und schoben an Jekaterinas Körper herum, versuchten ihren Oberkörper auf Kissen zu heben und ihre zuckenden Gliedmaßen ruhig zu halten. Subow stand auf und breitete die Arme aus.
»Kein Aderlass!« Seine befehlsgewohnte Stimme drang mühelos durch das Schluchzen und die aufgeregten Gespräche. »Nicht bevor Rogerson hier ist. Habt ihr ihn rufen lassen?«
Die Hofdame nickte und sagte stockend, während ihr Tränen über die Wangen liefen: »Er muss gleich da sein. Ich hab Boten geschickt.«
Subow rannte hinaus. Man sah ihn mit seinem Bruder Nikolai reden, der mehrmals nickte und einen militärischen Gruß andeutete. Mit polternden Schritten eilte er aus dem Arbeitszimmer der Zarin. Subow kam zurück, deutete auf die Ärzte, einige Kammerdiener und auf andere Männer, deren Gesichter er kannte. Seine Worte klangen wie Befehle.
»Vier Mann an jeder Seite! Die anderen zurück. Hebt die Zarin aufs Bett. He, ihr Kammerfrauen, heißes Wasser und Waschzeug. Seht ihr nicht, was …?«
Jekaterina in den beschmutzten, vom Urin durchnässten Kleidern, wurde nicht ohne Stolpern und mit einiger Mühe aufgehoben. Der schlaffe Körper rutschte und kippte zweimal aus den Armen der Männer. Die Laken auf der Matratze wurden unter Jekaterina gewechselt, und sie blieb zuckend, mit fleckiger Haut, neben dem Bett liegen. Die Feuer in den Kachelöfen loderten, die Kloben knisterten und knackten, und Hitzewellen breiteten sich unter den hohen Stuckdecken der Zimmer aus. Kammerdiener Sotow und der junge Geliebte der Kaiserin trieben mehr als ein Dutzend Palastbewohner aus dem Schlafraum hinaus; der Lärm und das Durcheinander mäßigten sich. Zwei Hofdamen versuchten, den Morgenmantel unter dem schlaffen Körper hervorzuziehen und die Schenkel der Kaiserin zu reinigen. Die Tür flog auf, und Alexander, Jekaterinas Enkel, stürzte mit fassungslosem Gesichtsausdruck und halb offener Litewka herein.
Subow stellte sich, den grässlichen Anblick schirmend, zwischen ihn und das Bett und sagte leise, aber eindringlich: »Großfürst! Eure Großmutter liegt zu Tode krank. Ihr solltet, wenigstens vorübergehend, die notwendigen Befehle geben.«
Alexander starrte ihn an. Er brauchte drei Atemzüge lang, um zu begreifen, dann fragte er heiser: »Sind Boten zu meinem Vater unterwegs, Fürst Subow?«
»Seit einer Viertelstunde.«
Alexander nickte, rannte hinaus und rief einige Befehle. Kurz darauf kam er zurück und sagte zu Subow: »Ich hab zur Sicherheit noch Adjutant Rostoptschin gebeten, zu Vater zu reiten, in kleiner Begleitung. Es wird wohl länger als einen Tag dauern, bis er hier sein kann.«
»Wir tun, was getan werden muss«, entgegnete Platon, »und so schnell und sicher wie möglich. Geht zu Eurer Großmutter, Fürst Alexander. Seht zu, wie die Mutter Russlands stirbt.«
»Und Ihr, Platon?« Fürst Alexander wischte Tränen aus den Augenwinkeln und starrte den Körper seiner Großmutter an, der schutzlos den Blicken der Umstehenden ausgesetzt war.
»Ich werde bei ihr sein, so lange wie nötig.«
Platon zog einen Schemel über die Teppiche, setzte sich schwer und stützte den Kopf in die Hände. Insgesamt eine Stunde dauerte es, bis der schottische Leibarzt kam, einen Aderlass vornahm und Jekaterinas Unterschenkel, Füße und Sohlen mit einer Salbe aus spanischen Fliegen einreihen ließ. Die weiße Haut der Unterschenkel, die unförmig angeschwollen waren, mehr aufgeschwemmt als sonst und voller Druckstellen vieler Finger und Hände, schien unter der Wirkung der Salbe rote Blasen zu werfen. Platon Subow nahm das verzweifelte Treiben um Jekaterina Alexejewna, Zarin des Russländischen Imperiums, mit langsam wachsender Entfremdung wahr. Er begann zu begreifen, widerwillig und verzweifelnd, dass sein Abstieg in die Bedeutungslosigkeit, aus der er gekommen war, in diesen Stunden begonnen hatte, an diesem neblig-frostigen Morgen, nach dem allzu kurzen Licht des Sonnenaufgangs.
Während die Hofdamen, Ärzte, Helfer und Kammerdiener an Jekaterinas Sterbelager ein hilfloses, nun aber leiseres Durcheinander verursachten, flatterten Erinnerungen wie jene erregten Käfigvögelchen durch Platon Subows Kopf. Er entsann sich der Tage, als er, Offizier der berittenen Garde, zum ersten Mal nach Zarskoje Selo beordert worden war; seinen Ruf und etliche Orden hatte er in einer Handvoll harter Gefechte gegen die Schweden redlich erworben. Es war im Jahre 1789, während Jekaterinas genialer und hochfahrender Geliebter – man munkelte, die Zarin und er hätten sich im Geheimen vermählt! – Grigori Alexandrowitsch Potjomkin, Fürst von Tauris, drei wichtige Städte im fernen Türkenkrieg nach kurzer Belagerung eingenommen hatte. Binnen weniger Wochen war Fähnrich Platon Subow von Jekaterina zu ihrem persönlichen Adjutanten ernannt worden.
O Zarin Jekaterina, dachte er und betrachtete die Rücken der Männer und Frauen, die sich um die sterbende Kaiserin scharten, warum musstest du mich verführen? Sie war im einundsechzigsten, er im dreiundzwanzigsten Jahr gewesen, als sie Fürst Mamonow verstieß; der Fürst hatte das Undenkbare gewagt und sich in eine jüngere, schönere Frau verliebt. Wenige Tage später war er, Platon, ihr geachteter, hart arbeitender persönlicher Adjutant in den Tagesstunden und ihr Liebhaber in manchen Nächten. Sie dürstete nach Leidenschaft und wollte geliebt werden. Ihr Körper mit den schweren Hüften und Brüsten war bis zum Bersten mit Sinnlichkeit gefüllt; trotz der Gebärnarben unter der Haut verwandelte sie sich in eine Erscheinung von jugendlicher Herausforderung. Sie wollte das unaufhaltsame Verrinnen der Zeit aufhalten, und scheinbar gelang es ihr auch, mit strahlenden Zähnen und hellen Blicken, im Kerzenlicht und zwischen Gläsern voll Wein oder Champagner. Ihr langes weißes Haar wurde weich, strahlend, war wie aus Fäden gesponnenen Silbers.
So viel kundige Leidenschaft hatte Platon bei keiner seiner jüngeren Beischläferinnen je erlebt. Jekaterina besaß die Erfahrung von vier Jahrzehnten, sie war wie Honig, Wodka und Brennnesseln gewesen.
Gleichzeitig hatte sie ihn verdorben. In bester Absicht. Der Aufstieg in die Gesellschaft des Zarenhofs war schwer gewesen; die Sprossen der langen Leiter starrten von vergifteten Dornen. Er war zu schnell und zu mühelos aufgestiegen, und seine einzige Gönnerin lag jetzt sterbend sieben Schritte vor ihm, die blauen Augen weit aufgerissen.
Wieder sprangen die Türflügel auseinander.
Subow kannte den Mann. Jekaterinas schottischer Leibarzt, Doktor John Rogerson, rannte herein. Er hob, sobald er Jekaterinas mitgenommenen Körper gesehen hatte, den Arm und rief: »Die zweite Apoplexie! Ich lasse sie zur Ader!«
Aderlass oder etwas anderes, dachte Platon, es ist gleichgültig. Sie wird sterben. Sie stirbt, und ich werde – trotz meiner bunten Drachen und dem feinen Violinspiel – einen tiefen Fall tun. Die unschuldigste fiedelnde Seele der Welt, hatte die Kaiserin geschrieben, während sie ihn zwang, zu lernen und neue Aufgaben bei Hofe zu übernehmen. Selbst wenn er mitunter nicht begriff, welche Bedeutung Schriftstücke und Akten hatten, glaubte er, seiner Aufgabe gerecht zu werden. Bald warf man ihm, selbstverständlich zu Unrecht, Arroganz und Hochmut vor und hasste sein zahmes Äffchen. Nun würden ihm alle Minister und Fürsten, die sich vor ihm verbeugt hatten, Unfähigkeit und Anmaßung nachsagen und über ihn siegen.
Eisigkalter Schweiß sickerte zwischen seinen Schulterblättern hinunter; er fühlte sich wie im Morgengrauen vor einer bewaffneten Attacke. Die hohen Türflügel – er saß an der Wand neben dem Eingang zum Schlafraum –, zu denen Jekaterina ihm einen Schlüssel gegeben hatte, wurden abermals aufgerissen und krachten zuschlagend in die klirrenden Schlösser. Zwei Knechte schleppten einen Zuber dampfenden Wassers herein.
Wie eine Fliege im Frühling, hatte Jekaterina unter ihm stöhnend geflüstert, fühle sie sich! Sie schenkte ihm Noten für seine Violine und klatschte, als er in Zarskoje Selos herbstlichen Gärten seine Drachen steigen ließ, zur Freude des kaiserlichen Hofstaats.
Subow hatte auf dem Schlachtfeld viele verwundete Männer sterben sehen, und abseits der Kämpfe auch sterbende Frauen und Mädchen. Er wusste, dass die Kaiserin diesen Schlaganfall nicht überleben würde. Eine Hofdame drehte sich um und sah in sein Gesicht. Der lange Blick schien Bedauern auszudrücken oder einen Anflug von Verachtung. Er gab den Blick zurück, bis sich die Frau wieder der röchelnden Kaiserin zuwandte. Keine Spur mehr von dem Entzücken der Damen über seine breiten Schultern und seine strahlenden Augen. Subow stemmte sich in die Höhe und näherte sich leise dem Kreis aufgeregter Menschen, die auf die Kaiserin hinunterstarrten. Fürst Alexander stand am Fußende der Matratze, hielt die Arme vor der Brust verschränkt und betrachtete aus halb geschlossenen Augen seine Großmutter. Sein Gesicht war starr, aber Subow sah die Tränen in den Augenwinkeln.
Der Körper der Greisin lag still da. In kurzen Abständen zitterten die Finger. Der Aderlass schien geholfen zu haben oder die Zäpfchen, oder die Medizin, die der Schotte ihr fast gewaltsam eingeflößt hatte; das Blut staute sich nicht mehr in Jekaterinas Gesicht. Sie atmete schwer; ihr keuchendes Röcheln unterbrach die lauten Atemzüge. Ihr Blick war zur Decke gerichtet. Es kam Platon Subow so vor, als kämpfte Jekaterina darum, das Bewusstsein wiederzuerlangen. Subow vermochte es nicht zu glauben. Er hörte, wie sich der schottische Arzt mit seinem Nachbarn, einem Palastarzt, murmelnd unterhielt, verstand aber kein Wort. Beide Männer schüttelten die Köpfe. Subow bewegte sich rückwärts zur Tür. Sein Blick umfasste die Bilder, Leuchter, Möbel und das große prunkvolle Bett. Er verließ still das Schlafzimmer und zog die schwere Tür ins Schloss.
Im Korridor, durch dessen ganze Länge eiskalte Luft zog, standen und saßen schweigende und weinende Diener und Beamte. Subow ging zwischen ihnen hindurch, die Treppe hinunter und zu seiner Suite, die zuvor Fürst Potjomkin gehört hatte. Das Äffchen sprang kreischend in seinem Käfig umher und warf mit Gebäckstücken nach Subow. Ohne das Tier zu beachten, durchquerte er den Raum. Auf dem Tisch lagen einige Stapel Schriftstücke. Er setzte sich, blätterte darin, las sie aber nicht. Bis Alexander oder Großfürst Paul ihm neue Befehle erteilte, galten für ihn Jekaterinas Anweisungen.
Um Mittag herum hielt Platon Alexandrowitsch Subow das Alleinsein und die Stille im Winterpalast nicht mehr aus. Die Ungewissheit über sein Schicksal begann seine Gedanken mehr zu beschäftigen als das Sterben der Kaiserin. Sie hatte ihn zu ihrem Geliebten gemacht, dies sah er nun als trostlose Wahrheit, und die Einsicht, dass seine Titel nur von ihrem Bemühen abhingen, ihn an ihrer Seite zu halten, steigerte seine Unruhe. Er sprang auf und ging in seiner Privatkanzlei hin und her; dicke Teppiche dämpften das Hämmern seiner Absätze. Das Äffchen verkroch sich in eine Käfigecke und starrte ihn zähnefletschend an. Ihn, Subow, »der Schwarzhaarige«, wie sein Spitzname lautete, von der Zarin ersonnen, die ihn zum Präsident des Kriegskollegiums, zum Gouverneur der taurischen Provinz, zum Befehlshaber der Schwarzmeerflotte befördert, zunächst gegen Potjomkins Widerstand, der befürchtet hatte, Jekaterina ließe sich von Subow beherrschen und unterwürfe sich seiner Jugend. Und später – Fürst Grigori Potjomkin hatte vor fünf Jahren diese Welt verlassen – sein Nachfolger. Jetzt waren die zärtlichen Namen »das Kind« oder »Potjomkins Fähnrich«, mit denen Jekaterina Subow ausgezeichnet hatte, bedeutungslos geworden.
Subow stieg die Treppe hinauf und betrat den schier endlosen Korridor. Zunächst schien ihn niemand zu erkennen, nach einigen Schritten nickten ihm die Menschen zu. Weinend, schluchzend oder wie erstarrt standen sie an den Wänden oder in kleinen Gruppen zusammen, als müssten sie sich gegenseitig wärmen und trösten. Längst würde es sich in St. Petersburg herumgesprochen haben, dass die Zarin zum zweiten Mal mit dem Tod rang. Subow grüßte zurück, durchquerte das Arbeitszimmer der Zarin und deutete auf die Doppeltür zum Schlafraum. Der Diener öffnete ihm einen Flügel.
Auf Zehenspitzen näherte sich Subow der Kaiserin. Jekaterina, dachte er während einiger beklommener Atemzüge, ist im eigenen Körper lebendig begraben! Wie nach dem ersten Schlaganfall wechselten in ihrem Gesicht und am Hals wieder totenähnliche Blässe und das Rot des Blutandrangs. Die Augen waren geschlossen, der Atem ging langsam und schwer, aber sie stöhnte nicht mehr. Die Mienen und Gesten der Ärzte waren ratlos und hoffnungslos, nur Doktor Rogerson schien sicher zu sein. Der lange Blick, den er über die Kaiserin hinweg auf Subow richtete, drückte aus, was Subow dachte:
Der Todeskampf dauert nicht mehr lange. Sie wird das Bewusstsein nicht wiedererlangen.