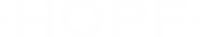Das Zimmer wirkte plüschig und überladen. Dicke Teppiche lagen auf dem Boden, kleinere, noch buntere Ausführungen hingen an den Wänden, dazu grelle Bilder in protzigen Goldrahmen. Allerlei Nippes und Plastikkitsch in schreienden Farben dekorierte das Vitrinenfach und den oberen Schrankaufsatz, Häkeldeckchen zierten Beistelltischchen und Polstergarnitur. Aus einer Mini-Kompakt-Anlage dudelten türkische Schlager.
Der feiste Mann auf der mächtigen Couch zählte angelegentlich das Geld, das in einem Häufchen zerknitterter Scheine vor ihm auf dem wuchtigen Holztisch lag. Neben den Banknoten standen drei hohe, schlanke Teetassen auf der Platte, die gleiche Anzahl Gläser und daneben eine halbvolle Flasche Raki, dem nicht nur im Land am Bosporus beliebten Anisbranntwein.
Zwei mit Lederblousons und Jeans bekleidete Gestalten lümmelten sich gelangweilt in den überdimensionalen Sesseln herum, in dem der kleine Dicke mit der Stirnglatze fast verschwand. Er reinigte sich mit einem Messer hingebungsvoll die Fingernägel, während der langhaarige Muskeltyp sich die Zeit mit dem Blättern in einem Magazin vertrieb, in dem es von leichtgeschürzten jungen Damen, vornehmlich Blondinen, nur so wimmelte. Hin und wieder nippten sie am Tee und blickten sehnsüchtig zur Schnapsflasche, trauten sich jedoch nicht, selbst nachzuschenken.
Endlich war der bärtige Türke auf dem Sofa mit Zählen fertig. Er nickte wohlgefällig, schob jedem der beiden drei Hunderter zu und steckte den Rest ein. Gönnerhaft schenkte er die drei Gläser voll und prostete den anderen Männern zu, die sich nicht zweimal bitten ließen und die hochprozentige Flüssigkeit wie ihr Gastgeber in einem Zug hinunterstürzten.
„Was macht unser Sorgenkind?“
„Der Kerl weigert sich nach wie vor, zu arbeiten.“ Das kurzatmige Schwergewicht tauchte aus den Polstern des Sitzmöbels auf und beugte sich nach vorn. „Machete hat ihm einen körperlichen Verweis erteilt …“
„Du weißt schon, Boss“, unterbrach der Muskeltyp und lachte meckernd. „Ein paar von jenen Schlägen, die Wirkung zeigen, ohne am Körper Spuren zu hinterlassen.“
„Es hat nichts genützt, also habe ich ihn ein wenig gekitzelt.“ Der Dicke deutete auf die dolchähnliche Waffe in seiner Hand. „Der Bursche stellt sich trotzdem stur.“
„Jetzt bin ich mit meiner Geduld am Ende“, wetterte der rundliche Mann auf der Couch. „Er schuldet mir über viertausend Mark und will das nicht abverdienen?“ Er füllte die Gläser erneut und trank einen Schluck. „Bisher habe ich jeden Pfennig, den ich vorgestreckt habe, mit Zins und Zinseszins zurückbekommen, und dieses Würstchen wird nichts daran ändern, ganz im Gegenteil. Ich werde ein Exempel statuieren, das der Kerl nicht vergessen wird. Und nicht nur er, sondern alle, die meinen, sie könnten sich ihren Verpflichtungen mir gegenüber entziehen.“
*
Drohend und düster, angenagt wie ein kariöser Zahn, ragte das Behördenhochhaus in den nächtlichen, sternenlosen Januarhimmel des noch jungfräulichen Jahres. Noch stand das Domizil der Stadtverwaltung, von dem aus seit September 1963 die Geschicke der mittelhessischen Metropole gelenkt worden waren, doch seine Tage waren gezählt.
Längst waren die Behörden aus dem einsturzgefährdeten Betonklotz ausgezogen, und schon bevor Gießen sein Doppeljubiläum 1997/98 beenden würde ‒ 800 Jahre Ersterwähnung, 750 Jahre Stadtrechte ‒ sollte er, gerade mal fünfunddreißig Jahre alt, abgerissen werden. Der Baustoff für die Ewigkeit hatte sich infolge Pfusch am Bau als relativ kurzlebig entpuppt. Hätte sich ein Architekt bei der Errichtung der Pyramiden einen solchen Lapsus erlaubt, hätte ihn der Pharao sicherlich köpfen lassen. Diese Gefahr bestand im zivilisierten Deutschland des 20. Jahrhunderts nicht, denn man hatte Justitia einfach die Augen verbunden, und als sie nichts mehr sehen konnte, schnell eine Verjährungsfrist für solche Stümperei ins Gesetzbuch geschrieben. Natürlich hatte man diese Texte in weiser Voraussicht nicht in Beton gegossen, sondern auf dem wesentlich robusteren Papier niedergeschrieben.
Die ersten Januartage waren nicht kalt, eher regnerisch und sehr windig. Heulend rüttelte der Sturm an den bloßgelegten, rostigen Stahlverstrebungen des Rathauses, verkrallte sich in dem morschen Gemäuer, riss Putzstücke und Fliesenreste ab und schleuderte sie zu Boden. Orgelnde Böen umtosten auch das benachbarte Landratsamt, das sich ängstlich in den Windschatten des maroden Riesen zu ducken schien.
Mit Titanenfäusten rissen die aufgepeitschten Luftmassen an den mächtigen Kronen der Baumriesen im nahen Botanischen Garten und brachten die pflanzlichen Methusalems zum Ächzen und Stöhnen. Wie Jo-Jos wippten die mittels Stahlseilen in luftiger Höhe befestigten Straßenlaternen über den Fahrbahnen auf und ab, Fahnen flatterten und zerrten an ihren Masten, als wollten sie mitsamt ihrer Verankerung endlich als Windjammer auf große Fahrt gehen.
Die bereits zum Abbau bestimmten, über Seltersweg und anderen Fußgängerzonen gespannten Weihnachtsdekorationen tanzten heftiger, als es angeheiterte, schunkelfreudige Kölner Karnevalisten beim Ausruf „De Zooch kütt!“ je getan hatten, und alles, was nicht schwer oder standfest genug war, entdeckte seine Mobilität und beschloss, auf Wanderung zu gehen ‒ leere Mülltonnen, abgestellte Eimer und allerlei Gerümpel.
Die vom Himmel fallenden Schauer trugen noch dazu bei, auch gutwilligen und wetterfesten Naturen den Aufenthalt im Freien zu verleiden. Es war nicht die Menge an feuchtem Nass, die abschreckte, sondern die Kombination aus Wasser und Wind.
Beinahe waagerecht trieb der Sturm den Regen durch die Stadt, wie Peitschenhiebe trafen die Tropfen die ungeschützte Haut, gegen die ein Schirm so gut wie nichts nützte. Mal wurde er so gepackt, dass er nur noch ein Wirrwarr aus Stoff und Stangen war, dann wieder wurde er zu einer Art Segel, das den Träger nach vorn oder hinten riss oder ihm, als Schild gehalten, das Vorwärtskommen fast unmöglich machte. Es war ein Wetter, bei dem man keinen Hund vor die Tür jagte.
Langsam ging es auf Mitternacht zu. Die Stadtbusse, für die der Berliner Platz, dem Standort des abbruchreifen Behördenhochhauses, eine wichtige Umsteigestation war, fuhren unbeeindruckt von Wind und Wetter diese Haltestelle an, doch Fahrgäste waren rar. Auch der sonst starke Autoverkehr war eher spärlich, und die Passanten, die hier tagsüber zu Dutzenden auf jede Grünphase der Fußgängerampeln warteten, ließen sich an einer Hand abzählen. Im nur einen Steinwurf entfernten Stadttheater hatte sich heute der Vorhang nicht gehoben, weil spielfrei war, und die ebenfalls benachbarte Kongresshalle hielt auch ihre Pforten geschlossen.
Etliche Gießener Bürger nutzten die arbeitnehmerfreundlichen Feiertage zu einem Kurzurlaub, und viele Studenten hatten die Gelegenheit wahrgenommen, die weihnachtliche Vorlesungspause an der Universität bei ihren Familien in heimatlichen Gefilden zu verbringen. Ein Teil der Bewohner war der Stadt vorübergehend abhanden gekommen, und von den Leuten, die sich hier aufhielten, gingen nur die nach draußen, die es unbedingt mussten.
Das vielgeschossige ehemalige Rathaus war dann ohnehin nicht das Ziel. Düster und heruntergekommen stand es da, mit finsteren Fensterhöhlen und verstaubten, blinden Scheiben, eine leb- und seelenlos gewordene Ruine. Unzählige Schicksale hatte sie in ihren Mauern erlebt, Freude und Leid, Ärger und Triumph, Bürokratentum und Menschlichkeit, Feindschaft und Zuneigung, Hinwendung und Ablehnung. Freundschaften und Liebschaften hatten sich hinter dem bröckelig gewordenen Beton angebahnt, Ehen und Scheidungen. Ein Mikrokosmos des Lebens waren die Amtsstuben gewesen, und nun waren die Tage des einst so stolzen Gebäudes gezählt.
Noch stemmte sich der Gigant aus Stahlbeton allen Witterungseinflüssen entgegen. Sturm und Regen verschluckten die Schrittgeräusche in seinem Treppenhaus, keine Stufe ächzte oder knirschte, als sich Füße auf dem Weg nach oben des Aufgangs bedienten, der offiziell längst gesperrt war.
Plötzlich zerbrach im zehnten Stock klirrend eine Scheibe, die schemenhaften Umrisse einer menschlichen Gestalt wurden in der dunklen Öffnung sichtbar. Sofort orgelte der Sturm durch das Loch in den dahinter liegenden Raum. Die Person strauchelte fast unter der Wucht der Böen, taumelte dem Fenster entgegen und klammerte sich dort fest. Einen Moment lang schien sie zu zögern, dann stürzte sie mit einem unartikulierten Schrei in die Tiefe.
Für Sekundenbruchteile war in den im Rahmen steckenden Glasresten ein helles Oval zu sehen. War es ein menschliches Gesicht, oder handelte es sich nur um die Spiegelung einer Straßenlaterne?
Ein Sog der aufgewühlten Luftmassen erfasste die schlanke Gestalt, katapultierte sie förmlich vom Gebäude weg und wirbelte sie wie ein abgerissenes Aststück über den Rand der tiefer liegenden, verandaartig vorspringenden Stockwerke weiter nach unten.
Beinahe lautlos, nur von einem dumpfen Schmatzen des nassen Untergrunds begleitet, schlug der zierliche Körper auf dem zerwühlten, völlig durchweichten Rasen auf, der das ehemalige Stadthaus zur Ostanlage hin umgab.
Niemand hatte die Tragödie mitbekommen. Die entfesselten Luftmassen übertönten mit ihrem schaurigen Geheul jedes andere Geräusch. Die ganze Nacht über lag die Tote dort auf dem schlammigen Boden neben dem Schild, das das Betreten des Gebäudes verbot. Erst am nächsten Morgen wurde der leblose Körper von einem Frühaufsteher entdeckt, der seinen Hund dort Gassi führte.
Der Mann selbst hatte dem durchnässten grauen Bündel keine Beachtung geschenkt, doch als sein Foxterrier gar nicht aufhörte, es zu verbellen, hatte er nachgesehen. Erschüttert und entsetzt zugleich war er zur nahen Polizeistation II gelaufen, die gleich hinter dem Behördenhochhaus untergebraucht war, und hatte seinen grausigen Fund gemeldet.
2.
Die Ausstattung wirkte dem Gewerbe angemessen. Sonnenstrahlen wurden durch geschickt angebrachte Jalousien und Vorhänge am Eindringen gehindert, und was sich an Tageslicht trotzig und schüchtern zugleich in den Raum verirrte, wurde gelenkt, geleitet und durch Gardinen gebremst. Halogenlampen und Deckenfluter übernahmen den Part der Sonne, nicht grell und aufdringlich, sondern gezielt gesteuert und eher diffus.
Dem zeitlosen Mobiliar sah man auf dem ersten Blick an, dass es aus massivem Holz bestand. Ob Kirschbäume, Palisander oder exotischere Gewächse für diese Schreinerkunst ihr Leben gelassen hatten, war nicht auf Anhieb zu erkennen. Mit dem gleichen Material waren die Wände verkleidet, ein dunkelgrauer Teppich aus dichtem, Schall schluckenden Flor bedeckte den Boden.
Keine Pflanze hätte in diesem Halbdunkel mehr als einen Monat überdauert, dennoch waren etliche Vertreter des Pflanzenreichs in Kübeln vertreten: Exotische Palmfarne, Lorbeerbäumchen und strenge, stammlose Palmen mit starren Wedeln vermittelten eher Düsternis als frisches Grün. Die Heiterkeit ihrer ursprünglichen Heimat war ihnen gründlich ausgetrieben worden, denn es waren Geschöpfe, die der Mensch geschaffen hatte: Naturidentisch. Weniger verschämt gesagt: künstlich.
Da der Fortschritt vor keiner Branche Halt machte, war neben dem obligatorischen Telefon in mitternachtsblau ‒ was im Prinzip schwarz ist ‒ natürlich auch ein PC vorhanden. Sein Gehäuse war in Anthrazit gehalten, und die Konsole prangte in tristem Stahlgrau, ein Ton, der in diesem Umfeld fast schon wie ein fröhlicher Farbtupfer wirkte. Ein wenig gewöhnungsbedürftig waren die Regaldekorationen: Urnen aller Art und Couleur standen da mehr oder weniger dekorativ herum. Keine offerierte sich als Sonderangebot, sondern signalisierte unmissverständlich wie ein Manifest die Vergänglichkeit des Lebens.
Das zarte Läuten der Tür ertönte, eine Mischung aus Armesünderglöcklein und Heilsbotschaft. Ein paar der zu dieser Jahreszeit eher seltenen Sonnenstrahlen huschten über die Schwelle, dann fielen zwei Schatten in den Raum. Der Mann im dunklen Zwirn hinter dem Schreibtisch wurde lebendig. Er sprang nicht auf, wie es in anderen Branchen üblich war, wenn ein Kunde das Geschäft betrat, sondern er erhob sich würdevoll und ging gemessenen Schrittes auf die beiden Männer zu. Mit gesenktem Kopf deutete er eine Verbeugung an und schüttelte jedem die Hand. Der Griff war zuversichtlich, die Miene auch, aber Leiden und Mitleid waren trotzdem wie eingemeißelt.
Frank Wilhelm deutete auf die Stühle vor seinem Schreibtisch, zog behutsam die Tür ins Schloss und nahm etwas umständlich hinter dem wuchtigen Büromöbel Platz. Für einen kurzen Augenblick musterte er die Besucher. Dieses berufsmäßige Taxieren hatte zweierlei Gründe. Zum einen diente es der Einstufung in die richtige Preiskategorie, und zum anderen der Einschätzung des Seelenlebens des oder der Klienten.
Der eine der Männer mochte etwa vierzig Jahre alt sein, hatte ein rundes Mondgesicht mit einem mächtigen Seehundbart und schüttere, schwarze Haare. Unter dem offenen blauen Mantel trug er einen altmodischen grauen Anzug, der seinen wohlbeleibten Körper einzwängte wie eine Wurstpelle. Der andere war schätzungsweise Mitte Zwanzig, sehnig und gut einen Kopf größer als sein Begleiter. Er trug einen lila Jogging-Anzug und darüber einen grünen Parka.
Für Leute, die ein Bestattungsinstitut aufsuchten, war die Kleidung schon sehr ungewöhnlich. Ihrem Aussehen nach handelte es sich um keine Mitteleuropäer; vermutlich waren es türkische Staatsbürger. An diesem Punkt seiner Überlegungen angekommen, bemerkte der werdende Vater hinter dem Schreibtisch, dass seine Schweißporen ihre Arbeit aufnahmen und feine Perlchen auf seine Stirn zauberten. Nicht, dass er etwas gegen Menschen anderer Herkunft hatte, aber er hatte noch nie einen Moslem beerdigt. Welche Vorgaben waren da zu beachten, welche Rituale mussten eingehalten werden, welche Zeremonien verlangte der Koran?
„Meine Herren, was kann ich für Sie tun?“, fragte Wilhelm salbungsvoll und geschäftstüchtig zugleich, dabei ein bisschen forscher als üblich, weil er seine Unsicherheit verbergen wollte.
„Osman Özergümir“, stellte sich der Ältere vor und zückte einen amtlichen Ausweis. „Ich bin Sozialarbeiter und bin Herrn Yildiz“, er deutete auf seinen Begleiter, „dabei behilflich, die nötigen Formalitäten und Behördengänge zu erledigen. Seine Frau ist vorgestern auf eine sehr tragische Weise ums Leben gekommen.“
„Verstehe.“ Frank Wilhelm erhob sich und reichte Yildiz erneut die Hand. „Darf ich Ihnen zum Heimgang der teuren Verflossenen mein aufrichtiges Beileid aussprechen?“
Es war eine Floskel, Standard, Routine oder wie immer man es auch nennen wollte, und Frank Wilhelm wartete darauf, dass der Schnauzbart die Worte übersetzte, doch zu seiner Überraschung antwortete der Angesprochene selbst in einwandfreiem Deutsch mit unverkennbarem hessischen Einschlag.
„Danke. Auch für Ihre Anteilnahme.“ Der Mann im Jogging-Anzug wischte sich verstohlen über die Augen. „Die Polizei ist nicht so taktvoll.“
Jetzt war der Bestatter völlig verwirrt. Fragend blickte er von einem zum anderen.
„Bitte, Martin, es geht doch hier um ganz andere Dinge.“ Özergümir legte seine Hand beruhigend auf den Arm seines Begleiters. „Wir haben bereits ausführlich darüber gesprochen, doch wenn du willst, unterhalten wir uns später noch einmal in aller Ruhe. Aber ändern kann das auch nicht Herr …“
„Ich bitte um Entschuldigung.“
Eilfertig zog Wilhelm eine Schreibtischschublade auf, entnahm ihr zwei Visitenkarten und schob sie den beiden hin.
„Frank Wilhelm ist mein Name.“
„Herr Wilhelm kann da auch nichts tun. Er ist Bestatter und kein Polizist oder Staatsanwalt.“
„Das weiß ich. Aber der Tod von Bircan war weder ein Unglücksfall noch Selbstmord“, begehrte Yildiz auf.
Der Sozialarbeiter machte ein strenges Gesicht. „Bitte, Martin, reiß dich jetzt mal zusammen. Ich weiß, wie schwer der Verlust für dich ist, aber wir sind hierhergekommen, um die Bestattungsformalitäten zu erledigen und nicht, um Herrn Wilhelm deine Geschichte zu erzählen.“
„Ist ja gut, Osman, ich bin schon still.“
Özergümir wandte sich Frank Wilhelm zu.
„Herr Yildiz stammt aus der Türkei und ist Asylbewerber. Die Beerdigung wird also vom Sozialamt bezahlt.“ Der Schnauzbart wühlte in seiner Aktenmappe und zog eine Liste hervor, die er dem Bestatter reichte. „Finanzielle Spielräume gibt es nicht. Dieses Formular enthält eine Aufstellung, was und in welcher Höhe bezahlt wird.“
Wilhelm legte das Blatt achtlos zur Seite und seufzte unhörbar. Das war mal wieder so ein Geschäft, das ihm zwar Arbeit bescherte, aber kaum Gewinn brachte.
„Ich kenne die Vorgaben“, sagte er mit säuerlichem Unterton und fügte hinzu: „Aber leider nicht die Anforderungen, wie ein Muslim zu bestatten ist.“
„Meine Frau und ich sind evangelisch“, warf Yildiz ein.
„Ach!“, entfuhr es dem Mann hinter dem Schreibtisch. „Ich habe mich schon über Ihren ganz und gar nicht türkischen Vornamen gewundert.“
„Mein Vater hat mich nach Martin Luther genannt. Er war fast fünfzehn Jahre lang als Gastarbeiter bei Opel in Rüsselsheim tätig und ist zum Christentum konvertiert. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. 1989 bin ich dann mit der ganzen Familie zurück in die Türkei.“
„Dann wäre dieses Problem also gelöst.“ Frank Wilhelm fiel ein Stein vom Herzen. „Für eine christliche Beerdigung ist unser Institut natürlich prädestiniert.“
„Kann ich mal sehen, wie meine Frau beerdigt wird?“, erkundigte sich der Jüngere mit bewegter Stimme. Man merkte, dass er um seine Fassung kämpfte. „Ich meine, was das Sozialamt bezahlt?“
„Natürlich.“ Frank Wilhelm nahm sein Musterbuch zur Hand, blätterte darin und zeigte nacheinander auf verschiedene Abbildungen.
„Diesen Sarg, diese Sargauskleidung, dieses Totenhemd und ein Bukett in dieser Art.“
„Danke.“ Yildiz war den Tränen nahe. „Immerhin bekommt sie einen richtigen Sarg. Im Heim haben sie erzählt, verstorbene Asylbewerber würden in einer Pappkiste beerdigt.“
Der Bestatter, der es täglich mit trauernden Hinterbliebenen zu tun hatte und seine Anteilnahme auf Distanz halten musste, wenn er nicht irgendwann ein Fall für die Psychiatrie sein wollte, spürte Mitleid in sich aufsteigen.
„Wissen Sie was, Herr Yildiz? Unser Institut bezahlt Ihnen noch einen Kranz auf eigene Kosten. Was soll denn auf der Schleife stehen?“
Der junge Mann wischte sich über die Augen und brachte tatsächlich ein Lächeln zustande. „Vielen, vielen Dank, Herr Wilhelm, Sie sind ein echter Christenmensch.“ Er überlegte nicht lange. „Von Martin und den Kindern.“
„Sie haben Kinder?“
„Ja, zwei. Ein und drei Jahre alt.“
Betroffen klappte Wilhelm den Katalog zu, notierte den gewünschten Text und räusperte sich. „Haben Sie den Totenschein dabei?“
„Ja, hier bitte!“ Özergümir kramte in seiner Tasche und legte das gewünschte Papier auf den Schreibtisch. „Frau Yildiz befindet sich noch in der Pathologie. Können Sie sie dort abholen?“
„Selbstverständlich.“ Der Bestatter wandte sich an den jungen Witwer. „Wo kann ich Sie erreichen?“
„Im Asylantenheim im Meisenbornweg.“
„Gut. Ich melde mich bei Ihnen.“
Die beiden Besucher standen auf, bedankten sich artig und verabschiedeten sich. Wilhelm begleitete sie zum Ausgang, schloss die Tür hinter ihnen und kehrte zum Schreibtisch zurück. Erst jetzt besah er sich den Totenschein genauer: Bircan Yildiz, geboren am 1. August 1977, gestorben am 5. Januar 1998. Sie war gerade mal zwanzig Jahre alt geworden.