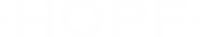In unregelmäßigem Takt glitten die Milchglastüren auseinander und mit der üblichen Palette europäischer Marokkoreisender – Neo-Hippies, Pauschaltouristen und ausgebrannten Lehrern – drängte Max Slabon in den Ankunftsbereich. Er war Anfang zwanzig, schlaksig und besaß eine beneidenswerte Sonnenbräune, die man nicht während eines Kurzurlaubes erwerben konnte. Unruhig hielt er Ausschau nach der versprochenen Mitfahrgelegenheit und machte einen dicken Kerl in Chauffeuruniform aus, der mit einem Becher Kaffee in der Hand an einer Wand lehnte und rauchte, neben ihm ein Pappschild mit Max‘ Namen. Als der Chauffeur ihn bemerkte, warf er die Kippe in den Kaffeebecher, wo sie zischend erlosch, und beides zusammen in den Mülleimer neben ihm. Dann stieß er sich mit den Schultern von der Wand ab und entblößte ein grellrotes Rauchverbotsschild.
Die Fahrt dauerte fast eine Stunde. Max sah teilnahmslos aus dem Fenster und rutschte auf den Ledersitzen herum. Nach drei Monaten im Kaftan musste er sich erst wieder an eng anliegende Kleidung gewöhnen. Und an Unterwäsche. Seit der Landung versuchte er, sich innerlich auf die Begegnung mit seiner Familie vorzubereiten. Ihre Nachricht hatte auf absolute Dringlichkeit gepocht, aber ansonsten keine Informationen enthalten. Das schwarze Schaf sollte schnellstmöglich zurückkehren. Der Verlierer, der es zu nichts gebracht hatte, der auf Familienfotos immer am Rand stand und meistens nicht mehr in den Bildausschnitt passte. Als er vor einem Jahr sein Jurastudium geschmissen hatte, überraschte dies niemanden in der Familie und der letzte Funken Interesse an ihm war erloschen. Sie schickten ihm seine monatlichen Schecks und interessierten sich nicht für sein selbst gewähltes Exil.
Der Fahrer brachte ihn nicht zum Familiensitz. Die Stadt lag längst hinter ihnen und um sie herum befand sich beinahe unberührte Natur. Der Wagen passierte das steinerne Tor einer Privatklinik und fuhr rasant durch die weitläufigen Grünanlagen. Hier hatte Max den empfohlenen Routinecheck machen lassen, bevor er nach Marokko gereist war. Hatten sie etwas Gravierendes gefunden, weil sie ihn holen ließen?
Der Wagen hielt auf einem Vorplatz mit Springbrunnen.
»Ist jemand krank?«, fragte Max, doch der Chauffeur zuckte nur mit den Schultern.
Am Ende eines Seitenflures wartete die Familie. Max wurde nervös. Sie standen ihm nicht wirklich nahe. Aber wenn sie alle zusammengefunden hatten und ihn in eine teure Privatklinik kommen ließen, dann konnte er ihnen nicht völlig gleichgültig sein. Andererseits bedeutete dies auch, dass es etwas wirklich Ernstes sein musste. Er sah die Anspannung auf den Gesichtern. Nur das seiner Schwester Kim fehlte. Ausgerechnet die Einzige in der ganzen Bande, die ihm etwas bedeutete. Wenn er sich nicht irrte, befand sie sich gerade auf Japan-Tournee.
»Max«, sagte sein Vater knapp und streckte ihm förmlich die Hand hin.
»Jetzt, wo du da bist, wird alles gut werden«, schniefte seine Mutter und strich ihm beiläufig über den Arm. Die Cousinen winkten ihm kurz zu und wandten sich sofort wieder den Displays ihrer Handys zu. Ihre Gefühle gaben sie nur per SMS weiter. Sein Großvater saß abseits in einem Sessel und fand es nicht einmal der Mühe wert, sich zu erheben. Stattdessen betrachtete er missbilligend seine Enkelinnen und kümmerte sich nicht weiter um Max.
Ein älterer Mann kam durch den Flur geeilt.
»Endlich«, keuchte Professor Knecht, Leiter der Klinik und gleichzeitig Hausarzt der Familie. Er war ein guter Freund seines Großvaters. In Max‘ Besorgnis mischte sich Reue, weil er so schlecht über seine Familie gedacht hatte. Seine Eltern, die ihm doch alle Möglichkeiten geboten hatten, sein Großvater, der ihn vor der Entdeckung von Kims Talent recht anständig behandelt hatte, und sein Onkel, der auch ihn unterstützen würde, gäbe es irgendetwas, das er vorzuweisen hätte. Hoffentlich musste Kim ihre Tournee nicht absagen, weil sie ihm beistehen wollte.
»Keine Sekunde zu früh, junger Mann.«
»Ist es so schlimm?«, krächzte Max.
»In solchen Fällen ist es wichtig, dass eine Familie zusammensteht und füreinander da ist. Das sehen Sie doch genauso?«
»Auf jeden Fall, aber was habe ich denn nun?«
»Es gehört Courage dazu, in der Blüte seines Lebens eine solche Entscheidung zu treffen. Das ist mutig und selbstlos und Ihre Familie kann zu Recht stolz auf Sie sein. Meine Hochachtung, junger Mann.«
»Wovon reden Sie bitte?«
Die Erkenntnis traf ihn ohne Deckung und die Wucht war durch die Rührung der letzten Minuten umso stärker. Er bemühte sich, keine Regung zu zeigen, doch als er Wut und Enttäuschung hinunterschlucken wollte, entstand ein Würgen in seiner Kehle. »Der Zustand Ihrer Schwester muss Ihnen doch aufgefallen sein«, sagte der Arzt mit einem vorwurfsvollen Unterton. Max‘ Zorn wich augenblicklich der Besorgnis. Natürlich hatte Kim schlecht ausgesehen. Das tat sie seit Jahren. Immer dann, wenn sie nicht gerade auf der Bühne stand.
Zuletzt hatte er sie nach einem Konzert in Bremen gesehen. Damals fand er, dass sie dringend Urlaub benötige. Sie war blass gewesen, hatte ständig gegähnt und sich gedankenverloren an den Armen gekratzt. Während ihres Gesprächs hatte sie Pillen geschluckt. Er hatte alles dem Stress und der Erschöpfung durch ihren gnadenlosen Terminplan zugeschrieben. Kim nahm Tabletten gegen Depressionen, Tabletten, um schlafen zu können, und Tabletten gegen Müdigkeit. Morgens Tabletten gegen schlechte Stimmung und um munter zu werden, mittags gegen Sodbrennen, Bluthochdruck und Kopfschmerzen, abends um zu entspannen und gegen die Übelkeit, die durch all die Medikamente ausgelöst wurde .
»Ihre Schwester leidet unter einer chronischen Niereninsuffizienz.«
»Wird sie sich wieder erholen?«
Der Arzt schien zu überlegen, ob er Max‘ Naivität mit einem sarkastischen Spruch parieren sollte, aber dann seufzte er mitfühlend und führte ihn ein Stück zur Seite, als wolle er ihm einen Gefühlsausbruch in Gegenwart der anderen ersparen.
»Chronisches Nierenversagen ist nicht rückgängig zu machen. Das zerstörte Gewebe lässt sich nicht wieder herstellen. Tut mir leid.«
Der Arzt sah ihn über den Rand seiner Lesebrille an.
»Sie sind mit den grundlegenden Funktionen der Nieren vertraut?«
Max nickte zögernd.
»Dann ist Ihnen klar, dass es für Ihre Schwester um Leben und Tod geht?«
Er nickte wieder.
»Wie sieht die Alternative aus?«, fragte Max.
»Dauerhafte Dialyse. Dreimal die Woche, jeweils vier bis fünf Stunden. Das bringt natürlich Einschränkungen für Lebensführung und Beruf mit sich.«
Max lachte bitter auf.
»Sie wissen, wer meine Schwester ist?«
»Natürlich.«
»Weiß meine Familie, was Sie mir gerade gesagt haben? Okay, vergessen Sie die Frage! Natürlich weiß sie es, sonst wäre ich nicht hier. Wann soll die Operation stattfinden?«
»Sobald Sie Ihre Einwilligung geben.«
Max betrachtete seine Familie. Sie mussten seine Eignung als Spender schon vor Jahren getestet haben.
»Eine Frage noch: Bin ich der einzige mögliche Spender?«
»Nein. Natürlich wären da auch andere, ihre Eltern beispielsweise. Wichtig ist, dass Blutgruppe und Gewebemerkmale möglichst optimal übereinstimmen.«
»Hat sich einer von ihnen testen lassen?«
»Äh, bisher noch nicht.«
»Danke.«
Sie hatten sich kein bisschen geändert. Seine Eltern lächelten verkrampft. Onkel Gregor wirkte ungeduldig und sein Großvater schien regelrecht verärgert zu sein. Der Ausdruck auf seinem Gesicht sagte alles. Er hasste Max wegen der Zeitverzögerung, die das Leben seiner kostbaren Enkelin gefährdete. Wäre es nach ihm gegangen, hätte man Max wohl an Ort und Stelle in Marokko die benötigten Organe entnommen und den Rest liegen gelassen. Max‘ Großvater, ein Patriarch alter Schule, der innerhalb der Familie die Zügel fest in der Hand hielt, war sehr empfindlich, was die Verschwendung wichtigen Lebens anging. Er hatte eine sehr klare Vorstellung, was die Bedeutung eines Lebens ausmachte: Erfolg. Wer erfolgreich war, war wertvoll – und Kim Slabon war sehr wertvoll. Sie war eine der erfolgreichsten Pianistinnen der Welt. Mit dreizehn hatte sie ihre erste CD aufgenommen, nachdem sie alle relevanten Nachwuchspreise gewonnen hatte. Inzwischen lebte die ganze Familie von Kim, und zwar sehr gut. Ihr Onkel war der Manager, Vater verwaltete treuhänderisch das Vermögen und Mutter kümmerte sich als ausgebildete Maskenbildnerin um Kims Make-up und die Garderobe. Der Großvater, selbst als Musiker gescheitert, erkannte in seiner Enkelin sein genetisches Erbe und erhob Anspruch auf ihren Erfolg. Sie hatten Kim in allen Belangen bevorzugt und Max seine Minderwertigkeit erklärt, als sei es eine wissenschaftlich bestätigte Tatsache. Diese Begünstigung durch die Familie hatte jedoch sein Verhältnis zu seiner kleinen Schwester nie getrübt.
»Wie geht es Kim? Kann ich sie sehen?«
»Sie schläft«, wiegelte seine Onkel ab.
»Verstehe. Dir wäre es am liebsten, wenn ich meine Niere am Hintereingang abgebe und dann wieder verschwinde.«
Seine Mutter machte einen Schritt vor.
»Bitte, Max, du weißt, wie viel wir in ihre Ausbildung und Karriere investiert haben. Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein.«
»Sohn, ich befehle dir, deiner Schwester zu helfen«, dröhnte sein Vater. Max sah ihn geringschätzig an. Er war ein armseliges Würstchen, das sich widerstandslos von der Sippe manipulieren ließ. Unter anderen Umständen hätte die Familie ihn wahrscheinlich längst ausgebootet, aber er war nun einmal Kims Vater.
»Ich brauche einen Moment, um das zu verdauen.«
»Zeit ist genau das, was uns fehlt«, bemerkte der Arzt.
»Verdauen? Was gibt es da zu verdauen? Es geht um das Leben deiner Schwester!«, brüllte Onkel Gregor.
»Reden wir nicht lange drum herum«, tönte sein Großvater, »frag ihn, wie viel er verlangt!«
Max‘ Mutter schluchzte laut: »Du solltest dich schämen. Sieh dir an, was deine Schwester erreicht hat, und das willst du ihr kaputt machen? Aus purem Neid? Pfui Teufel!«
Sie dachten wahrscheinlich, dass er Geld aus der Sache herausschlagen oder sich rächen wollte. Möglichkeiten, die ihrem eigenen Charakter oder ihrem schlechten Gewissen entstammten. Auf die Idee, dass er seiner Schwester aus Liebe helfen könnte, kamen sie nicht. Max musste lachen.
»Ihr seid einfach unglaublich, wisst Ihr das?«
»Genug geredet«, sagte sein Onkel und legte ihm von hinten die Arme um die Brust. Max sträubte sich, gegen seinen Paten handgreiflich zu werden, andererseits hatte der nie etwas getan, um sich Max‘ Sympathie zu sichern. Er hob den Fuß und trat mit dem Absatz auf den Schuh seines Onkels. Professor Knecht hob aufgeregt die Arme.
»Sind Sie wahnsinnig? Der Mann muss für die Operation vorbereitet werden.«
»Er ist gleich so weit«, stieß Gregor hervor.
»Ich spreche von Voruntersuchungen. Das ist doch keine Metzgerei hier.«
»Hilf mir endlich, ich kann ihn nicht länger halten«, rief Gregor Slabon seinem Bruder zu und Max sah, wie sein Vater auf ihn zueilte. Er kam sich vor wie auf der Bühne eines Boulevardtheaters, nur leider wurde hier keine Komödie gegeben. Kraftvoll trat er ein zweites Mal zu und diesmal lockerte sich Gregors Griff. Max drehte sich um die eigene Achse und schüttelte seinen Onkel ab.
»Max.«
Kim stand in der Tür ihres Krankenzimmers, gestützt von ihren Cousinen. Ihre ohnehin blasse Haut schimmerte gelblich-grau, ihr Haar war fettig und unter den Augen hatte sie schwarze Ringe. Max bekam bei ihrem Anblick eine trockene Kehle. »Ich möchte mit Max sprechen. Allein.«
Ihr Onkel wollte protestieren, doch sie ließ ihn nicht ausreden. Ihre Hand war dünn und blass, als sie nach Max‘ Handgelenk griff.
»Hallo Schwesterchen«, sagte er endlich und folgte ihr ins Zimmer.
Zwanzig Stunden später, nach zahlreichen Untersuchungen, die Max geduldig über sich ergehen lassen hatte, fand die Operation statt. Als der Professor in den privaten Warteraum kam, erhoben sich alle Familienmitglieder gespannt von ihren Plätzen. Mutter Slabon klammerte sich an den Arm ihres Mannes und bohrte ihm ihre Fingernägel ins Fleisch. Die beiden Cousinen blickten von ihren Handys auf und hielten die Daumen in Warteposition, um die neuesten Nachrichten an die Verwandten zu Hause weitergeben zu können.
»Die Operation ist gut verlaufen.«
»Wann können wir hinein?«
»Das wird noch eine Weile dauern, aber wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Sie sollten alle nach Hause gehen und versuchen, etwas Ruhe zu finden.«
»Wie geht es meinem Großvater?«, fragte Kim nervös. Die aufgeschminkten Krankheitssymptome hatte sie längst entfernt und sie sah so rosig und gesund aus, wie man sie von den Konzertplakaten kannte.
»Wir müssen abwarten. Der Körper betrachtet das neue Organ als Fremdkörper und attackiert es. Ihr Großvater wird lebenslang Medikamente nehmen müssen, um seine Immunabwehr zu unterdrücken. Dadurch wird er anfälliger für Infektionen sein als andere Menschen, aber seine Chancen stehen gut.«
Zufrieden verabschiedete sich die Familie. Gregor Slabon zog einen Umschlag aus seinem Jackett und reichte ihn dem Arzt.
»Da ist alles drin? Alle Negative? Es gibt keine weiteren Kopien?«
»Sie sind jetzt wieder ein unbescholtener Bürger, Herr Professor«, sagte Gregor und legte reichlich Verachtung in die Betonung des Titels. Der Arzt steckte den Umschlag erleichtert ein.
»Gönnen Sie Ihrem Vater in nächster Zeit etwas Ruhe.«
»Versteht sich von selbst.«
»Eine Herztransplantation ist in seinem Alter kein Zuckerschlecken.«
Gregor räusperte sich.
»Was ist mit der anderen Sache?«
»Der Totenschein ist fertig. Es wird keine Fragen geben. Die Beerdigung wird so schnell wie möglich abgewickelt werden.«
Gregor schüttelte ihm die Hand und folgte seiner Familie zum Ausgang.
»Herr Slabon?«, rief ihm der Arzt nach.
»Ja?«
»Mein aufrichtiges Beileid.«