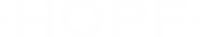Als ich Ferdinand Hergert zum ersten Mal begegnete, hielt ich ihn für einen Spinner. Einen liebenswerten, aber dennoch einen wilden Fantasten mit allzu überbordender Fantasie.
Mehr als ein halbes Leben ist das jetzt her. Und es wundert mich noch immer, dass ich, zu der damaligen Zeit eher introvertiert, denn kontaktfreudig, mit Ferdinand vom ersten Augenblick an in ein vergleichsweise angenehmes Gespräch verstrickt war. Ein Gespräch geprägt von einer Vertrautheit, die durch nichts zu erklären war.
Nun, er machte es einer Person wie mir, die damals eher dem Zuhören, als der Kommunikation zugeneigt war, nicht allzu schwer, da er ohnehin beständig von diesem, jenem und allem am Reden war. Er kam, wie es so schön heißt, vom Stock aufs Stöckchen, was sehr häufig in ellenlange Monologe ausuferte. Anstrengend war es und ermüdend zuweilen. Aber in all der langen Zeit, seit wir damals unseren jugendlichen Spinnereien nachhingen, habe ich genügend Erfahrung gesammelt und Möglichkeiten gefunden, seinen Redefluss, wenngleich nicht zu stoppen, so zumindest zu unterbrechen, um ein Gespräch neu zu gestalten oder wieder in die ursprünglichen Bahnen zurückzulenken.
Damals, mit Anfang zwanzig, eher noch ein Schweiger, denn ein Redner, fand ich es trotzdem seltsam, dass er ausgerechnet dann neben mir stand, als ich mich intensiv mit einem der ausgestellten Original-Panels aus François Schuitens Graphik-Novelle »Les Cités obscures / Die geheimnisvollen Städte« eingehend befasste und gedankenverloren damit auseinandersetzte.
»Faszinierend, wie Monsieur Schuiten eine fremdartige Atmosphäre mit vertrauter Architektur kombiniert«, sprach er mich von der Seite her an. Es waren seine ersten an mich gerichteten Worte.
»Hm?« Fragend tauchte ich aus meiner Betrachtung und blickte in amüsiert blitzende Augen. Er war etwas größer als ich. Offensichtlich in gleichem Alter, wenn ihn auch eine eigenartige Aura von Erfahrung umgab, die keinesfalls typisch zu nennen war. »In der Tat.« Nicht unfreundlich, aber doch deutlich verstimmt über die Störung, fiel meine kurze Antwort aus.
Doch anstatt mich wegzudrehen, wie es sonst der Fall gewesen wäre, wandte ich mich diesmal nicht von dem Störenfried ab und ging meiner Wege. Nein, ich blickte in das offene Gesicht meines Gegenübers und gab meine gewonnenen Eindrücke zum Besten. So entspann sich eine angeregte Unterhaltung über feine Strichführung, klare Linien, Ausdrucksstärke, frühe und moderne Architektur, reale Welten und jene, die, fantasiegeboren, dennoch existieren konnten ‒ irgendwo im Nirgendwo.
Ja, nirgendwo. Exakt dieses NIRGENDWO sollte, ist und wird auf ewig wohl unsere gemeinsame Freundschaft und die daraus resultierende Verbindung beschreiben.
Was auch immer uns damals zusammengeführt hatte, sei es nun Zufall, Fügung, Schicksal oder Bestimmung, egal, was dieser ersten Begegnung folgte, war eine sehr lange, zeitweilig lose und doch immer intensive Freundschaft. Im Verlauf unserer unzähligen Treffen hatte Ferdinand Hergert begonnen, mir von einer realen Imagination zu berichten. Von einer Realität, die der uns umgebenden nicht unbedingt fremd ist. Sie wäre wohl am ehesten vergleichbar mit den fiktiven Szenarien einer Film- oder Spielewelt. Der Unterschied läge jedoch in ihrer tatsächlichen Existenz.
Dem Unbegreiflichen schon immer zugeneigt, musste Ferdinand schon damals meine Bereitschaft gespürt haben, absonderlichen Dingen, wenn schon nicht Glauben zu schenken, so doch vorbehaltlos daran teilzuhaben. War ich doch selbst oft genug mit unbegreiflichen Geschehnissen konfrontiert, von denen nur wenige, mir sehr nahe stehende Personen, Kenntnis hatten. Eines Tages nahm ich ihn auf in den Kreis der Eingeweihten, als ich wieder einmal in die Verlegenheit kam, Erläuterungen abzugeben. Meist in Form von bruchhaften Informationen, um sie vor dem Befremdlichen zu schützen, oder weil sie unfreiwillig Zeuge verstörender Ereignisse geworden waren. Keiner jedoch wusste die ganze Wahrheit, wodurch ihr Leben allerdings nicht zwangsläufig weniger kompliziert beeinflusst wurde. Als Ferdinand mir aber zu vermitteln versuchte, dass es ihm gelungen war, dieses, in unseren unzähligen Gesprächen, oftmals als NIRGENDWO bezeichnete Reich entdeckt zu haben und in dessen Realität eingetaucht zu sein, war ich dann doch mehr als nur skeptisch.
Ferdinand war schon immer ein genialer Erzähler gewesen. Er konnte ganze Romane so lebendig nacherzählen, dass niemand, dem er davon berichtete, das Buch oder die Geschichte zur Hand nehmen musste. Dieser fantasiebegabte Träumer konnte mit seinen Geschichten Stunden füllen, ohne zu langweilen. Sie aufzuschreiben hätte gelohnt. Allein die Inhalte waren flüchtig, wie die Worte, die in atemloser Stille zwischen den Zuhörern verklangen. Keiner dachte in diesen Momenten daran, sie festzuhalten und zu bewahren.
Meine unausgesprochenen Zweifel verletzten ihn tief, das spürte ich. Doch er wurde es nicht müde, mir zu beteuern, dass alles von dem, was er versuchte, mir mit eindringlichen Worten zu schildern, tatsächlichen Erlebnissen entsprach.
Eines Tages, viele Jahre später, erzählte mir Ferdinand von der Einsamen Stadt, wie er sie nannte. Einer Stadt, die auf dem Bruchstück einer zerborstenen Welt durch das Dunkel des Æthers trieb. Ich war zu verblüfft, als dass ich ihn nach der Herkunft seines Wissens fragte. Denn exakt dieses Szenario hatte ich entworfen, um für meine bis dahin verfassten Geschichten und dem daraus entwickelten Brettspiel ›Weltenbaum‹ einen zentralen Hintergrund zu schaffen.
Eine Situation, die noch in weiter Ferne lag und wovon noch zu erzählen ist.
Trotz aller Skepsis lauschte ich dennoch, fasziniert von seinen Ausführungen, und tat sie nicht rundweg als Humbug ab. Bald erinnerte ich mich, es immer bedauert zu haben, seine früheren Erzählungen nicht bewahrt zu haben, und so begann ich, unsere Gespräche auf Tonband heimlich mitzuschneiden.
So ging es lange Zeit, bis die Abstände zwischen unseren regelmäßigen Treffen immer größer wurden. Die Gemeinsamkeiten blieben, doch die Interessen verschoben sich. Verantwortlichkeiten drängten dazwischen. Die Vertrautheit im Wissen um unsere Freundschaft blieb davon unberührt. Aber aus einst nächtelangen Gesprächen waren inzwischen kurzweilige Stunden geworden, in denen die Erörterung der Aspekte des NIRGENDWO nur noch selten unsere Unterhaltung beherrschte.
Es verstrichen Wochen, später lagen Monate zwischen unseren vereinbarten Begegnungen. Irgendwann erschien Ferdinand Hergert nicht an dem üblichen Treffpunkt. Es kam immer wieder mal vor, dass er die Termine aus irgendwelchen Gründen hatte verschieben müssen. Da seine beständigen Reisen ihn rastlos von Ort zu Ort trieben, hatte er bislang alle Zusammenkünfte organisiert und bestimmt. Niemals zuvor war er einem Treffen fern geblieben, ohne sich zu melden. Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich also nicht, wo in aller Welt er sich diesmal aufhielt. So blieb mir nichts anderes übrig, als auf ein Lebenszeichen von ihm zu warten.
Es kam keine Nachricht. Er blieb verschwunden.
All den Spuren, die ich aus spärlichen Erkenntnissen nachverfolgen konnte, verliefen im Sand. Ferdinand blieb unauffindbar.
Ein seltsamer Zufall vor ein paar Jahren brachte mir dann die traurige Gewissheit, dass ich Ferdinand Hergert wohl nicht mehr würde begegnen können. Im Zusammenhang mit dem Aufarbeiten der von mir über lange Jahre archivierten Manuskripte des Ætheronauten Maark Bendart stieß ich auf eine Erzählung, in der eine Person namens Ferdinand Hergert eine nicht unwichtige Rolle spielt.
Es war wenig tröstlich, auf Umwegen über diesen verschlungenen Informationspfad zumindest ein Lebenszeichen meines Freundes zu erhalten. Und eine späte Einsicht traf mich wie ein Blitz: Ich hatte ihm unrecht getan, all seinen Beteuerungen zum Trotz, ich hatte ihm nicht geglaubt. Es beschämt mich immer noch, auch in diesen Momenten, da ich dies niederschreibe.
Doch bei all meiner Trauer darüber, ihm wohl nie mehr in die Augen schauen zu können, erfüllt es mich doch mit Freude, dass er im NIRGENDWO seinen Platz gefunden hat.
Unter diesem Eindruck und auch als Zeichen verspäteter Einsicht, den Wahrheitsgehalt seiner Behauptung zu akzeptieren, dass es ihm tatsächlich gelungen war, einen Weg in die Realität des NIRGENDWO zu finden, habe ich beschlossen, nach den vergessenen Tonbändern zu suchen.
So hatte ich damals gedacht und entsprechend gehandelt und damit begonnen, das Material zu sichten und zu bearbeiten. Die Realität jedoch sollte meinem Vorhaben sehr bald schon ein verblüffendes Ende bereiten.
Doch möchte ich an dieser Stelle nicht den Geschehnissen vorgreifen.